 In Österreich hält sich hartnäckig das Gerücht vom genialen Strategen Schüssel. Magazine schwärmen von seiner quantencomputerschnellen Auffassungsgabe und seinen raffinierten Tricks bei langstündigen Verhandlungen. Konservative Kommentatoren zeichnen das Bild eines hyperintelligenten, mit allen politischen Wassern gewaschenen Alpha-Tieres, der in Sekundenschnelle zwischen langjähriger Strategie, kurzfristigem Spindrehen und gefinkelten Ablenkungsmanövern tänzelt. Zudem ist Schüssel in den Augen seiner Anbeter ein hochmusischer Zeitgenosse, souverän in der Rede, am Cello gewandt und sicher im Umgang mit dem bitterbösen Karikaturenstift.
In Österreich hält sich hartnäckig das Gerücht vom genialen Strategen Schüssel. Magazine schwärmen von seiner quantencomputerschnellen Auffassungsgabe und seinen raffinierten Tricks bei langstündigen Verhandlungen. Konservative Kommentatoren zeichnen das Bild eines hyperintelligenten, mit allen politischen Wassern gewaschenen Alpha-Tieres, der in Sekundenschnelle zwischen langjähriger Strategie, kurzfristigem Spindrehen und gefinkelten Ablenkungsmanövern tänzelt. Zudem ist Schüssel in den Augen seiner Anbeter ein hochmusischer Zeitgenosse, souverän in der Rede, am Cello gewandt und sicher im Umgang mit dem bitterbösen Karikaturenstift.
Ein jesuitisch gesalbter Tausendsassa, der seinen Macchiavelli, seinen Gracian, seinen Clausewitz aus dem ff.kennt. Dem politischen Gegner, Haschtrafikanten, Sozialromantikern und dem wirtschaftlich unbedarften Proletariat wird zumindest zugestanden, die vielen Talente der Lichtgestalt am ÖVP-Feldherrnhügel wenn schon nicht zu respektieren, so doch zu fürchten.
Die verblüffende Wendung, 2000 als Drittstärkster den Kanzler zu machen und der fulminate Wahlsieg 2002 haben dieses Image vom Goldkanzler mit der eisernen Faust selbst in der Wahrnehmung der vehementesten Gegner verfestigt. Sogar die Donnerstagmarschierer gaben nach Wochen verbittert auf. Ob im Parlament oder auf der Strasse: Gegen Schüssel war kein Kraut gewachsen. Das Bild vom genialen Strategen schien unzerstörbar.
Stimmt es überhaupt?
Im Jahr 2000 wurde zwar regulär gewählt, die Nationalratsperioden waren aber längst aus dem Trittt geraten, weil Schüssel 1995 als frischgekürter Nachfolger von Erhard Busek im Windschatten von günstigen Umfragen einen Knatsch mit Vranitzkys Sozialdemokraten inszenierte. Genial daneben: Leicht dazugewonnen, trotzdem Zweiter geblieben. Bei der Wahl 2000 ging es nun endgültig den Bach runter. Schüssel wurde Dritter hinter dem feixenden Haider. Da hatte Schüssel aber längst Kanzlerblut geleckt.
Der fassungslose Klestil wurde überfahren, der unbedarfte rote Kanzler Klima in harten Verhandlungen gefesselt. Gleichzeitig paktierte Schüssel geheim mit dem gefährlich populären Haider. Über die Geschäftsbedingungen dieses Deals wird die Zeitgeschichte forschen. Jedenfalls blieb Haider in Kärnten und Schüssel kletterte auf den Bundskanzlersessel. In die Ministerien torkelten Witzfiguren.
Der Mythos vom genialen Strategen war geboren. Nächster und einziger Schritt im Strategiepapier Schüssels: Die Hegemonie der Volkspartei für die nächsten 100 Jahre zu sichern. Auf deutsch: ÖVP für immer. Divide et impera.
Divide hiess: Zerschlage Haiders Partei in kleine Teile. Divide hiess: Trenne die Sozialdemokratie von ihren starken Armen. Diskreditiere ihre Wirtschaftskompetenz, vernichte die Gewerkschaft. Impera hiess: Umgib dich mit Deppen und Jasagern, vernichte Deine innerparteilichen Gegner. Kontrolliere das Fernsehen. Kontrolliere die Presse. Basta.
Der erste Schritt des Plans war auf sechs Jahre ausgelegt. Dann sollte nach der Matrix der CSU die ewige Absolute kommen. Ein Sechsjahresplan deswegen, weil Schüssel als Kanzler in die EU-Präsidentschaft gehen musste, um als Europalenker die Ernte einzufahren, sprich: die absolute Mehrheit für die ÖVP.
Dazu musste aber frühzeitig gewählt werden. Darin hatte Schüssel Erfahrung. Ein Richtungs-Streit in der FPÖ kam gerade recht. Ob er billig war, werden die Zeitgeschichteforscher eruieren. Mit dem sympathischen Finanzminister Grasser an Bord fuhr Schüssel 42% ein. Haider war Geschichte, seine Wähler waren zu Schüssel übergelaufen.
Vier Jahre Zeit, die SPÖ zu vernichten. Die Schraube wurde angezogen. Der öffentliche Rundfunk wurde umgefärbt und in die Pflicht genommen, das Nachrichtenwesen auf Hofberichterstattung zurückgefahren. Nach der Folie Bruno Kreiskys wurde Grasser als der bessere Androsch aufgebaut. Fescher, klüger, erfolgreicher, teurer verheiratet. Unwiderstehliche Frisur.
Im Wahljahr sollte es dann passieren. Erst die glanzvolle Inszenierung Schüssels als Europas Chef. Treffen mit den Grossen der Welt. Küsschen mit Merkel, Bussi mit Bush. Dann die Vernichtung des Gegners. Die Bombe, lange vorbereitet und sorgsam im Finanzministerium gehütet, wurde gezündet: Malefikationen der Gewerkschaftsbank, Versagen der Gewerkschaft. Der GAU der Sozialdemokratie.
Alles andere als eine kleine, feine Absolute (©Andreas Khol) schien undenkbar. Für den Fall der Fälle wäre der kleine Mehrheitsbeschaffer BZÖ zur Verfügung gestanden. Oder die Haschtrafikanten von den Grünen. Soweit die Strategie.
 Was ist tatsächlich passiert? Bis auf die gewonnene Wahl 2002 (bei der sich bei genauem Hinschauen nur Stimmen von der FPÖ zur ÖVP verschoben) hat die Volkspartei unter der genialen Strategie von Lichtkanzler Schüssel mindestens 19 Wahlen verloren. Verloren hat die ÖVP unter den Fittichen des genialen Strategen die Landeshauptmänner in zwei Bundesländern (Steiermark und Salzburg). Unerwartet den Bundespräsidenten (Der konservative Strassenbahnersohn Thomas Klestil starb an den Spätfolgen von Kränkungen und einer mysteriösen Viruserkrankung, Ersatzkandidatin Benito Ferrero-Waldner ging tränenreich unter). Verloren gingen trotz abenteuerlicher Wahl- und Kontrollmechanismen der ORF und die Hochschülerschaft.
Was ist tatsächlich passiert? Bis auf die gewonnene Wahl 2002 (bei der sich bei genauem Hinschauen nur Stimmen von der FPÖ zur ÖVP verschoben) hat die Volkspartei unter der genialen Strategie von Lichtkanzler Schüssel mindestens 19 Wahlen verloren. Verloren hat die ÖVP unter den Fittichen des genialen Strategen die Landeshauptmänner in zwei Bundesländern (Steiermark und Salzburg). Unerwartet den Bundespräsidenten (Der konservative Strassenbahnersohn Thomas Klestil starb an den Spätfolgen von Kränkungen und einer mysteriösen Viruserkrankung, Ersatzkandidatin Benito Ferrero-Waldner ging tränenreich unter). Verloren gingen trotz abenteuerlicher Wahl- und Kontrollmechanismen der ORF und die Hochschülerschaft.
Und schliesslich versagte das Wahlvolk.
Es wählte Alfred Gusenbauer.
Kein Wunder, dass der geniale Stratege und sein Anbetungsverein nicht mehr weiter wissen.
Andrea Maria Dusl für das Ösi-Blog in der ZEIT. Danke an Matthias Cremer (Schüssel von hinten) und Erwin Wurm (Der Einfall des Einfamilienhauses in den Museumsbunker)

 Meine erste Begegnung mit dem Telefon fand im Kindergarten statt. Der Apparat, war rot und aus Plastik und er hatte alles was man so brauchte. Hörer, Wählscheibe, Spiralkabel und einen kleinen weissen Knopf. Telefonieren ging so: Du hobst den Hörer ab, drücktest auf den kleinen weissen Knopf und liessest es dreimal läuten. Läuten bedeutete salbungsvoll und ernst: ”Ring, riiiing, riiiihiiing” zu rufen. Meine Telefonpartnerin sass schon bereit. Mit gespieltem Erstaunen hob Sie den Hörer ihrer kleinen Kommunikationsmaschine ab und meldete: “Hallo, hallo, hier Regina Novak, wer ist am Apparat?” “Hallo, ja, hier Andrea Dusl, gut dass Sie abheben, mir ist das Waschmittel ausgegangen, ob sie wohl noch welches haben?” ”Selbstverständlich, kommen Sie doch in den Kaufmannsladen, wir haben gerade neues Omo bekommen.” “Danke”, “Danke”, Klick. Klick. So ging telefonieren.
Meine erste Begegnung mit dem Telefon fand im Kindergarten statt. Der Apparat, war rot und aus Plastik und er hatte alles was man so brauchte. Hörer, Wählscheibe, Spiralkabel und einen kleinen weissen Knopf. Telefonieren ging so: Du hobst den Hörer ab, drücktest auf den kleinen weissen Knopf und liessest es dreimal läuten. Läuten bedeutete salbungsvoll und ernst: ”Ring, riiiing, riiiihiiing” zu rufen. Meine Telefonpartnerin sass schon bereit. Mit gespieltem Erstaunen hob Sie den Hörer ihrer kleinen Kommunikationsmaschine ab und meldete: “Hallo, hallo, hier Regina Novak, wer ist am Apparat?” “Hallo, ja, hier Andrea Dusl, gut dass Sie abheben, mir ist das Waschmittel ausgegangen, ob sie wohl noch welches haben?” ”Selbstverständlich, kommen Sie doch in den Kaufmannsladen, wir haben gerade neues Omo bekommen.” “Danke”, “Danke”, Klick. Klick. So ging telefonieren. An Alfred Gusenbauer, dem König von Ybbs und Gewinner der Wahl wird sich der Altbundeskanzler in den anstehenden Koalitionsverhandlungen noch die Zähne ausbeissen. Gusi, wie ihn sogar seine Lebensgefährtin nennt, ist in einer win-win-Situation. Als gewiefter Schnapser ist er dem gfeanzten Schüssel verhandlungstechnisch ebenbürtig. Aus Koalitionsverhandlungen wird er besser aussteigen, als sein Vorgänger Viktor Klima, Schüssels letzter ernstzunehmender Verhandlungspartner. Und der war kein Kartenspieler, sondern Kammbläser.
An Alfred Gusenbauer, dem König von Ybbs und Gewinner der Wahl wird sich der Altbundeskanzler in den anstehenden Koalitionsverhandlungen noch die Zähne ausbeissen. Gusi, wie ihn sogar seine Lebensgefährtin nennt, ist in einer win-win-Situation. Als gewiefter Schnapser ist er dem gfeanzten Schüssel verhandlungstechnisch ebenbürtig. Aus Koalitionsverhandlungen wird er besser aussteigen, als sein Vorgänger Viktor Klima, Schüssels letzter ernstzunehmender Verhandlungspartner. Und der war kein Kartenspieler, sondern Kammbläser. Wien, Leopoldstadt, Leopoldsgasse, Volksschule der Stadt Wien, gegenüber dem Geburtshaus von Otto Bauer. Sozialdemokratischer kann man als Boboine nicht wählen gehen. Mein Wahllokal befindet sich seit Menschengedenken, seit den Zeiten meiner Urgrossmutter, im hintersten Eck der Volksschule, es geht vorbei an Schülerscherenschnitten, Metallspinden und Klassenzimmertüren zu den freundlichen, aber hypernervösen Wahlzimmerzuweisern, einem kleinen Schnurrbärtigen und einer blondgefärbten Dame, beide in ihren 50ties. Hypernervös sind sie, weil sie Kettenraucher sind und hier im Schulgebäude nicht rauchen dürfen.
Wien, Leopoldstadt, Leopoldsgasse, Volksschule der Stadt Wien, gegenüber dem Geburtshaus von Otto Bauer. Sozialdemokratischer kann man als Boboine nicht wählen gehen. Mein Wahllokal befindet sich seit Menschengedenken, seit den Zeiten meiner Urgrossmutter, im hintersten Eck der Volksschule, es geht vorbei an Schülerscherenschnitten, Metallspinden und Klassenzimmertüren zu den freundlichen, aber hypernervösen Wahlzimmerzuweisern, einem kleinen Schnurrbärtigen und einer blondgefärbten Dame, beide in ihren 50ties. Hypernervös sind sie, weil sie Kettenraucher sind und hier im Schulgebäude nicht rauchen dürfen.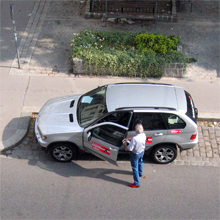 Der Hugo-Wiener-Platz liegt gegenüber von meinem französischen Atelierfenster. Zwei riesige Platanen stehen da vor den Sonnensegeln der polnischen Pizzeria, die den Sommer nicht überlebt hat, weil bei Regen niemand unter Sonnensegeln sitzen will. In der früh starten die Bobos ihre Minis und Saabs und Smarts und fahren in ihre kleine Galerie in der Schleifmühlgasse, ins Funkhaus in der Argentinierstrasse, in das vegane Naschmarktlokal. Dann wacht der Sandler auf, der an geraden Tagen auf der Bank unter der linken Platane schläft, an ungeraden auf der Bank unter der rechten Platane.
Der Hugo-Wiener-Platz liegt gegenüber von meinem französischen Atelierfenster. Zwei riesige Platanen stehen da vor den Sonnensegeln der polnischen Pizzeria, die den Sommer nicht überlebt hat, weil bei Regen niemand unter Sonnensegeln sitzen will. In der früh starten die Bobos ihre Minis und Saabs und Smarts und fahren in ihre kleine Galerie in der Schleifmühlgasse, ins Funkhaus in der Argentinierstrasse, in das vegane Naschmarktlokal. Dann wacht der Sandler auf, der an geraden Tagen auf der Bank unter der linken Platane schläft, an ungeraden auf der Bank unter der rechten Platane.

 Hannes Androsch war da schon weiter. Hannes Androsch war in den siebziger Jahren sowas wie der Mister Spock eines gewissen Captain Kreisky, er hatte eine Dienstlimousine und ein mobiles Telefon. Ein Telefon, das nicht an Kabeln aus der Wand hing, das nicht von der spärlichen Erreichbarkeit einer Vierteltelefonnummer desavouiert wurde, ein Telefon aus der Zukunft, ein Autotelefon. Es hatte die Grösse eines Kindersargs und war nur mit dickem Mercedes drumrum erhältlich.
Hannes Androsch war da schon weiter. Hannes Androsch war in den siebziger Jahren sowas wie der Mister Spock eines gewissen Captain Kreisky, er hatte eine Dienstlimousine und ein mobiles Telefon. Ein Telefon, das nicht an Kabeln aus der Wand hing, das nicht von der spärlichen Erreichbarkeit einer Vierteltelefonnummer desavouiert wurde, ein Telefon aus der Zukunft, ein Autotelefon. Es hatte die Grösse eines Kindersargs und war nur mit dickem Mercedes drumrum erhältlich. Und dann irgendwann ging alles ganz schnell. Im staatlichen Rundfunk sprachen sie über das Einrichten eines Funknetzes für mobiles Telefonieren. Geräte, die sich in dieses Netz einwählen würden, gäbe es bald zu kaufen. Zu kaufen! Und von diesem Funknetz, wie sie sagten, würde man auch ins normale Netz telefonieren können. Ins normale Netz!
Und dann irgendwann ging alles ganz schnell. Im staatlichen Rundfunk sprachen sie über das Einrichten eines Funknetzes für mobiles Telefonieren. Geräte, die sich in dieses Netz einwählen würden, gäbe es bald zu kaufen. Zu kaufen! Und von diesem Funknetz, wie sie sagten, würde man auch ins normale Netz telefonieren können. Ins normale Netz! Mein Handy. Mein Handy? Wie hiesss das Ding überhaupt? Manche nannten den dunklen Wecken “Funktelefon”. Andere wollten wissen, es hiesse Mobiltelefon. Und die Schöpfer von Worten wie Event und Marketing brachten “Handy” in Umlauf. Ein fataler Sprachirrtum, wie man spätestens nach einer Amerikareise wusste.
Mein Handy. Mein Handy? Wie hiesss das Ding überhaupt? Manche nannten den dunklen Wecken “Funktelefon”. Andere wollten wissen, es hiesse Mobiltelefon. Und die Schöpfer von Worten wie Event und Marketing brachten “Handy” in Umlauf. Ein fataler Sprachirrtum, wie man spätestens nach einer Amerikareise wusste. Das Madonnaphone war so schick, weil es den Madonnabügel hatte. Der Bügel erinnerte an die Wangenmikros, ohne die Popstars in den 90ern keine wirklichen Popstars waren. Den Madonnabügel schnalzte man mit dem Daumen raus. Dann gingen die Lichter an. Das war schon was! Das hätte Captain Kirk gefallen.
Das Madonnaphone war so schick, weil es den Madonnabügel hatte. Der Bügel erinnerte an die Wangenmikros, ohne die Popstars in den 90ern keine wirklichen Popstars waren. Den Madonnabügel schnalzte man mit dem Daumen raus. Dann gingen die Lichter an. Das war schon was! Das hätte Captain Kirk gefallen. Das Wort ist hart wie Stahl, flüchtig wie Nebel. Macht. Es riecht nach Lederfauteuils hinter dicken Polstertüren, nach Managerschweiss unter Armanituch, nach der süssen Würzigkeit echter Cohibas und dem Nussfurnier teurer Limousinen. Sein Klang oszilliert zwischen dem Seufzen einer unterschreibenden Mont-Blanc und dem animalischen Brüllen eines startenden Firmenjets. Macht kann vererbt sein, erkämpft, verteilt oder konzentriert. Sie kann Bürde sein und Droge. Jeder kennt sie. Viele fürchten sie, die meisten hätten sie gerne, und allen ist klar: Macht kommt vom Machen.
Das Wort ist hart wie Stahl, flüchtig wie Nebel. Macht. Es riecht nach Lederfauteuils hinter dicken Polstertüren, nach Managerschweiss unter Armanituch, nach der süssen Würzigkeit echter Cohibas und dem Nussfurnier teurer Limousinen. Sein Klang oszilliert zwischen dem Seufzen einer unterschreibenden Mont-Blanc und dem animalischen Brüllen eines startenden Firmenjets. Macht kann vererbt sein, erkämpft, verteilt oder konzentriert. Sie kann Bürde sein und Droge. Jeder kennt sie. Viele fürchten sie, die meisten hätten sie gerne, und allen ist klar: Macht kommt vom Machen. Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
 Arm ist ein hochkomplexes Wort. Das gilt für den Arm, jenen Körperteil, der unser wichtigstes Werkzeug, die Hand trägt gleichermassen wie für “arm” das Gegenteil von “reich”.
Arm ist ein hochkomplexes Wort. Das gilt für den Arm, jenen Körperteil, der unser wichtigstes Werkzeug, die Hand trägt gleichermassen wie für “arm” das Gegenteil von “reich”.