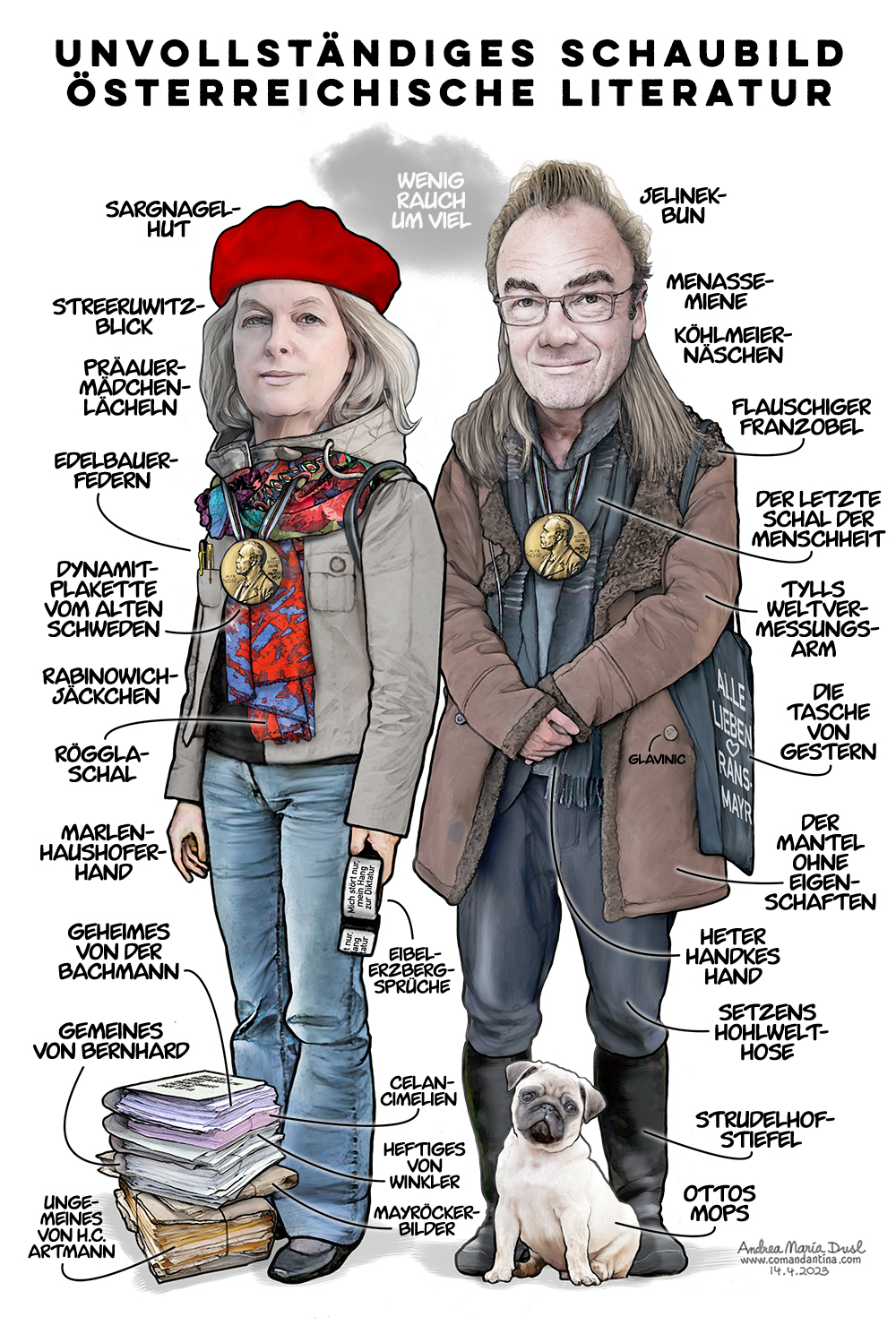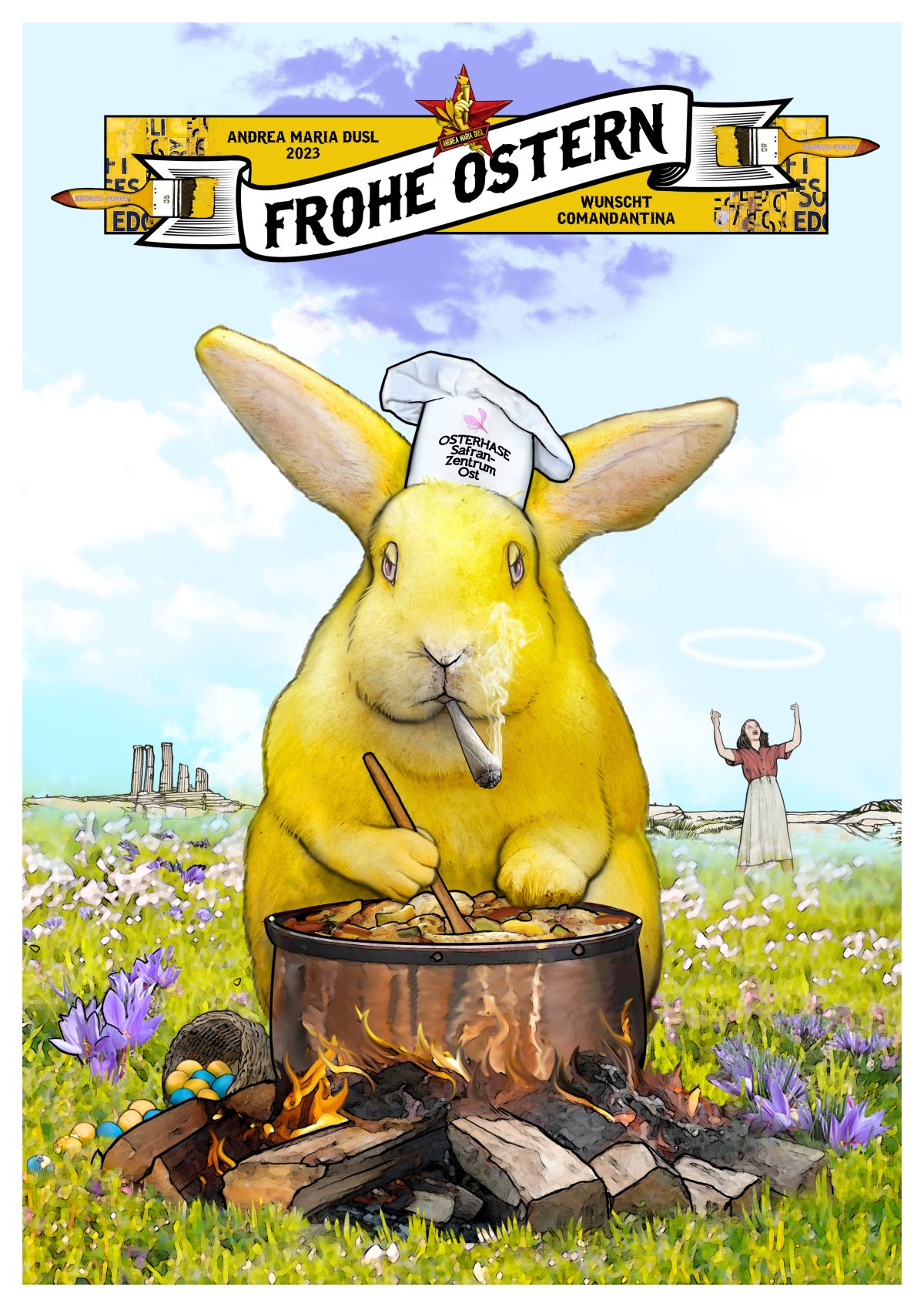Boboville hat 1968 begonnen, da war ich sieben, sieben auf einen Streich, es war Sommer und Boboville war heiß. Gegenüber vom rosagestrichenen Haus, wo am 1. Mai die roten Fahnen der Sozialisten hingen, gegenüber vom rosa Haus mit der Putzerei, ein schönes Bild, das rosa Haus der Sozialisten mit der eingebauten Putzerei, gegenüber von diesem Haus lag das Geschäft. Die Keimzelle von Boboville. Das heilige Geschäft. Das Bonbongeschäft. bonbons stand in großen Lettern über dem Geschäft. Bonbonville hätte ich meine Insel genannt, hätte ich als Kind gewusst, das Zuckerl und Bonbons das Gleiche sind.
Das Bonbongeschäft, es existiert noch heute, meine ich, vierzig Jahre nach 1968, es war rot gestrichen und ist es noch. Rotsein hatte eine Logik für mich, lange bevor das Wort in mein Leben treten sollte. Als Siebenjährige hielt ich es für richtig, wie ich es damals nannte, dass gegenüber von Onkel Christians rosa Sozialistenhaus mit der Putzerei das rote Zuckerlgeschäft lag. Seine Auslagen waren mit Krapfen geschmückt, mit Indianern, Pariserspitz, leeren, vergilbten Bonbonnierenschachteln. Mit gelber Plastikfolie war sie ausgelegt, die Auslage, darin lagen Vanillekipferl, zu kleinen Vulkanen aufgeschichtet, Mannerbruch in Scheiterhaufenform, Windringe in zirkulär geschichteten Windringringen. Und manchesmal stand eine Nusstorte in der Auslage. Mit einem dicken Kakaocremekringel an der Schulter, gekrönt von einer Walnuss. Oder war es eine Kaffeebohne, mit der Schamspalte nach oben in den Kakaocremekringel gedrückt?
Die Scheibe des Bonbongeschäftes hatte 1968, wenn man die Scheibe gut kannte, auf Kindernasenhöhe leichte Blindheiten. Die kamen von den gierigen Häuchen, die wir beim Anblick von Torten und Mannerbruchgebirgen auf den kalten Scheiben hinterließen. Ein Besuch des Bonbongeschäftes ohne minutenlanges Verharren an der Oberfläche der Bonbongeschäftauslagenscheibe wäre kein Besuch des Bonbongeschäftes gewesen. Man musste sich genau einprägen, was man brauchte. Ob und welches Torteneck, welche Kombination wievielwelcher Zuckerl. In unserer linken Kinderbobofaust befanden sich, zwischen gekrümmte Finger geklemmt, die Schillinge. Schillinge. Einschillinge und Zehngroschenscheiben und kleine, randgerillte Fünfziggroschenknöpfe. Abgezählt. Zu imaginierten Groschentürmen gestapelt.
Denn Boboville 1968, als ich sieben war, hinter den Zwergenbergen, war immer auch Berechnung. Wie viel sich wovon ausging mit wie viel an kinderbobofaustgewärmtem Metall. Die Berechnung dessen, was die linke Faust umklammerte. Um zehn Groschen, das musste man wissen, wenn man mit der Nase an der Zuckerlgeschäftscheibe hing, ging sich immerhin ein Stollwerck aus, die Grundwährung meiner Bobovillekindheit. Mit einem im Fußabstreifergitter vor der Putzerei gefundenen Zehngroschenstück ging sich in der Frühzeit von Boboville ein Stollwerck aus. Es war so groß wie ein Auge im Quadrat und so hoch wie zwei Schulhefte dick, es war eingewickelt in ein zwergentischtuchgroßes Wachspapier. Das Stollwerck. Das Wachspapier, man musste es ablösen, solange das Stollwerck kalt war. War es warm, klebte das Wachspapier am Stollwerck. Fünf Minuten milchzähneverklebendes Lutschen ging sich aus mit dem Zufallszehngroschenstück aus der Bobovilleputzerei im Sozialistengebäude, dem TheodorHerzl-Hof. Theodor-dem-Erfinder-von-Israel-Herzl-Hof. Dass die Gasse ums Eck Malzgasse hieß, hatte Richtigkeit für uns. Schmeckte doch das braune, klebrige Stollwerck nach Malz. Oder nach dem, was wir für Malz hielten. Wir. Wir, die Bobovillekinder vorm Bonbonvillegeschäft. Und wo waren wir her? Aus der Leopoldsgasse, aus der Schreygasse, aus der Rembrandtstraße, aus der Nestroygasse. Aus der Unteren Augartenstraße, aus der Malzgasse. Die, nach der das Malz in den Stollwerck seinen Namen hatte.
Das Bonbonvillegeschäft in der Leopoldsgasse war eine Art Maschine, eine Konsumboboismusmaschine, die erste Konsumboboismusmaschine der Welt. Das Bonbonvillegeschäft musste man besteigen, es war nicht ebenerdig zu betreten. Ein kleiner, halbstufenhoher Absatz führte in eine rotbemalte Nische, rot, wie ja alles Holz am Bonbonvillegeschäft rot gestrichen war. In einem Rot, das eine leichte Fähle hatte, ein sonnengeblichenes, vom blauen Himmel ausgelaugtes Rot. Ein Rot, wie wenn man von oben in ein Himbeerkracherl schaute. Es knirschte, wenn man die Betretungsnische des Bonbonvillegeschäfts bestieg, es machte knarrende Geräusche. Selbst dem federleichtesten Leopoldsgassenkind aus der Schreygasse, in jedem Fall war das immer ich, denn ich war das zarteste, kleinste und gewichtsloseste aller bonbonaffinen Kinder in Frühboboville, selbst dem Hauch eines Kindes gelang es nicht, die Eingangsnische ohne das Eintrittsknirschen zu besteigen. Das Knirschen war Teil der Maschinerie.
Der zweite Mechanismus der Bonbonvillemaschinerie war nicht minder geräuschvoll. Eine Türe, rot gestrichen war sie und dreiviertelgläsern, sie musste an einer Griffstange gehalten und gegen den Widerstand eines Kugelschnappmechanismus aufgedrückt werden. Der Bonbontürmechanismus schärfte mein Talent für technische Zusammenhänge. Ich hatte damals keine Ahnung und heute ebensowenig, wie das Schloss hieß, war es ein englisches Patent oder ein amerikanisches? Für das Kindermich war es eine kleine Messingnuss, die von einer Feder in die Außenwelt gedrückt wurde. Sie war mit honigfarbenem Schmierfett verklebt und roch nach Fahrradkette. Die Messingnuss hielt die Türe im Schloss. Man musste mit dem ganzen Gewicht eines zuckerschuldigen Kindes an der Türe drücken, um den Widerstand der honigschmierfetten Messingnussfeder zu überwinden. Das geschah, so es geschah, denn es war nicht leicht, stets mit einem Knall, von dessen mechanischer Erschütterung die Glasscheibe in der Bonbongeschäftstüre klirrte. Leicht, so dachten wir, könnte dieses Glas brechen und zu enormen Kinderschulden bei den Bonbongeschäftsinhabern führen. Schellende Ohrfeigen, markzersetzendes Angeschrienwerden, schmerzhafte Schüttelungen und daheim dann schlicht lebenslanges Fernsehverbot nach sich ziehen. Der Eintritt ins Bonbonparadies war untrennbar mit der Angst verbunden, die Zuckerpforte zu zerstören. Indes, das Dilemma war Teil einer ausgeklügelten Inszenierung. Nie nämlich, ja nie ist das Glas des Paradiesportals aus seinen Kittfugen gesprungen. Die Diabolik dieses Mechanismus war ebenso perfide wie gefürchtet.
Hatte man die Türe aufbekommen, schlug ihr Blatt rechts oben, eine Handbreit aufgedrückt, gegen ein Glöckchen. Als hätte das Knirschen der Betretungsnische und das Knallen der Türe nicht schon genug Bonbongeschäftsalarm ausgelöst. Knirschknallklingeling, das war, in Geräusche umgesetzt, das Süßigkeitenprogramm des Bonbonvillegeschäfts. Zuckerlkauf war ein Abenteuer, dessen Ritualpartikeln sich nicht alle von uns aussetzen wollten. Ich jedenfalls hatte bald eine Technik einstudiert, die Sesam-öffne-dich-Arbeit anderen aufzuschultern. Einem anderen Kind, einer Bonbonnierekäuferin, einem Schokohurtigen, einem Diabetiker auf Selbstzerstörungstour. Irgendjemandem jedenfalls, der die honigfette Nuss für mich aufdrückte. Sobald ein Helfer nahte, stellte ich mich in die Nähe der Eingangsnische, studierte den Mannerbruch, zählte die heidelbeergeschmackigen unter den Hellerzuckerln oder dachte mir sonst eine Unauffälligkeit aus. Das hatte ich mir von den Bienen abgeschaut. Die zuckelten doch auch zögerlich vor den Kelchen herum, um mit ihrem Schwirren andere Bienen zum Blütenbesuch anzustiften. Diese Vorgänge wollen deshalb in aller Ausführlichkeit erzählt werden, weil zum Verständnis Bobovilles das Verständnis für die Abweichung gehört. Bobovillains sind am Ungleichartigen interessiert, nicht am Uniformen. Auch von diesen Vorgängen wollten die Blindheiten stammen, die in Kindermundhöhe in die Auslagenscheiben geätzt waren. Von den Häuchen der Wartenden. Von den perfide vor dem Kelch taumelnden Kinderbienen.
Und dann kam sie, die dicke Hummel im Hubertusmantel, die Tortensuchende, den Seppelhut aufs weiße Lockengebirge drapiert. Und die knirschknalldrückte mir die Türe zum Süßigkeitenjerusalem auf.
Von Innen, das will ich gerne zugeben, ließ sich die bestialische Türe so leicht wie geräuschlos manipulieren. Von Innen sehen alle Initiationsrituale lächerlich aus. So geräuschvoll der Eintritt war, so leise, so sakristeihaft still war es im Inneren des Bonbongeschäfts. Ein Zimmerchen, von einer L-förmigen Glastheke beherrscht. Keine von den Bonbonischen befand sich je bei Eintritt in ihr Reich hinter dieser Budel. Die Bonbonischen befanden sich in lauernder Stellung, in der Tiefe ihrer Geschäftsräume. Ich entwarf ein Bild von ihnen, wie sie auf rosaledernen Sofas, im Lichte schokoladenfarbener Stehlampen vollgeklebte Fußballbilderalben studierten und Eskimoeiskataloge, Keksbestelllisten ausfüllten oder auch nur die Kreuzworträtsel in der Zuckerbäckerinnungsgazette. Vielleicht schliefen sie auch auf großen Schaumrollen? Designschaumrollen gewiss. Aus der Carnaby Street. Im Lichte himbeersaftfarbener venezianischer Luster.
Wie auch immer, nach dem Vergehen einer guten Minute krabbelte eine der Bonbonischen aus ihrem Versteck, nach meiner Erinnerung eine kleine, dicke Frau mit blaukarierter Textilviertelschürze, die Leopoldstädter Friseurbesuchsfrisur im Haar, zur Zeit, in der meine Erinnerung spielt, war es das silberblau getönte Lockenhaupt. Die Frisur der Gegend war uniform, silberblaue Dauerwelle. Nur Frau Natiesta im dritten Stock unseres Hauses in der Schreygasse, einen Apfelbutzenwurf von hier Richtung Leopoldsberg, hatte weißgoldenes Haar.
Die Bonbonische war mürrisch, sie hatte dicke Hände wie die Babuschkas in der Ukraine, wie die Waldviertler Kartoffelbäuerinnen. Dicke, kurze Hände. Und mürrisch war sie. Alle Bonbonischen sind mürrisch, anders als mit militanter Mürrischkeit lässt sich ein Bonbongeschäft nicht führen. Die Mürrischkeit paarte sich mit Präzision. Der Bonbonischen konnte man die ungeheuerlichsten Listen vortragen. Mehrstellige Listen. Listen, die von 17 weißen Stollwerck handelten, drei Liebesherzen, zwei Fizzersrollen, zwei Bazooka-Kaugummi-Paketen, drei Kuverts Fußballbildern, zwei Schlangen, zwei Colaflascherln aus Gummi, einer Packung Brause Orange, einer Packung Brause Zitron, einem Leberknödel.
Die Bonbonische hatte im Kopf mitnotiert, und schon beim Ausklang des Wortes Leberknödel, oder was auch immer das Ende der Liste markierte, die Summe parat. Dreizehn dreißig. Mehr als Dreizehn dreißig überstieg so ein Großeinkauf im Bonbongeschäft nie, und es war immer eine Kombination aus Groschen und Einschillingmünzen. Und immer zahlten wir sofort. Nach Bekanntgabe der Liste. Erst dann grub die Bonbonische in den Details und schichtete mit einer Genauigkeit, für die sie Uhrmacher beneideten, unser Zuckerwerk in weiße Papiersäckchen. Mit denen man später, waren sie leer und aufgeblasen, einen bobovilleerschütternden Knall machen konnte. Mürrische Genauigkeit. Die lernten wir bei der Bonbonischen. So waren die mehrstelligen Listen ja auch zusammengestellt worden, durch mürrisch genaue Kalkulation von Zuckerlpreisen. Zehngroschenscheiben ließen sich gegen Stollwercke tauschen, Fünfziggroschenknöpfe gegen Fizzersrollen, Bazooka-Gums, Brausesäckchen und Gummilutschzeug. Nur die Panini-Fußballbilder waren in Schillingwährung geerdet. Und der dicke, fette Leberknödel, das Zweischillingmonster. Sein wuchtiger Preis folgte gestalterischer Logik. Nach dem Essen der Nougatbombe war der Kindermagen verklebt. Nicht mal Brause konnte dann den fetten Nougatleberknödel durch den Bauch spülen. Der Nougatleberknödel war der Gruftdeckel des Zuckerlgrabs.
Das Reich der Bonbonischen war im Gegensatz zu den anderen Geschäften auf der Insel auch an Sonntagen geöffnet. Manchesmal musste ich hier Sonntagsmilch für daheim einkaufen. Oder Sonntagskaffee. Oder Sonntagszucker. Die Bonbonischen verwahrten Milch auch an Nichtsonntagen in einem Geheimkühlschrank. Denn die Zuckerlgeschäftkonzession verbot 1968, im Jahr, als am Boulevard SaintGermain die Pflastersteine flogen, gewiss den Verkauf von ungezuckerten Nahrungsmitteln. Es war mir damals schon bewusst: Geschäft ist immer auch Verbrechen. Milch verkaufen, wo Milchverkauf verboten ist. Kaffee verkaufen, wo Kaffeeverkauf verboten ist.
Bei den Bonbonischen saßen manchmal Leute vom Grund. Ausgemergelte Gestalten bei einer Tasse schwarzen Mokkas, die sich vorgaukelten, bei den Bonbonischen etwas für die Gesundheit zu tun. Mokka und Underberg tranken sie, an einem Resopaltischchen sitzend, und auch wenn sie dabei keine Falk inhalieren durften und keine Ernte 23, war das für die Ausgemergelten gewiss so gesund wie Zuckerzeug für Kinderzähne.
Das himbeerkracherlrote Bonbongeschäft gegenüber von Herzls sozialistischer Dampfbügelei ist der Nabel von Boboville. Auch wenn andere Bobovillains von anderen Nabeln wissen wollen. Von Nabeln im Village oder im Marais. Oder Umbilicae in Castro, Mitte und Kreuzberg. Alles Quatsch. Der Omphalos von Boboville ist das rot gestrichene Bonbongeschäft gegenüber vom rosa Gemeindebau, der nach Theodor Herzl benannt ist. Gestern habe ich das Schreiben des Bobovillebuchs unterbrochen, um in einem hastigen Anflug von Bekümmerung in die Leopoldsgasse zu fahren und Nachschau zu halten, ob das Bonbongeschäft überhaupt noch existiert. Ich parkte vor dem rosa Gemeindebau, wie es sich für Bobovillains gehört, mit drei Rädern im Kriminal, auf der Bushaltestelle nämlich. Mein Schreck war groß. Das Bonbongeschäft existiert. Unverändert. Sogar die gelben Plastikbahnen in seinen Auslagen sind noch da. Etwas gebleicht von der Leopoldstädter Sonne.
Aus: Dusl, Andrea Maria: Boboville, Residenz Verlag, St. Pölten/Salzburg, 2008, pagg. 10ff.