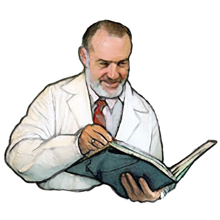Erschienen in .copy 25/März/2005
 Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
Um uns Schülerinnen und Schülern eine Vorstellung von dieser wundersamen Errungenschaft namens „EDV“ zu geben, brachte unser Mathematikprofessor eines Tages einen Streifen fahlgelben Plastiks mit, den er uns stolz als „Lochkarte“ präsentierte. „Das ist EDV, Schülerinnen und Schüler! Diese kleinen Löcher da. Diese kleinen Löcher, sie sind reine Information! Diese kleinen Löcher. Reine Information. Digitale Information.“ Wow! Information. Digital. Wow!
Aber wie ging das: „Digitale Information“?
Daß „ein“ gestanztes Loch den Wert „Eins“ repräsentierte, leuchtete mir noch halbwegs ein, aber daß „kein“ gestanztes Loch den Wert „Null“ darstellen sollte, blieb mir unerklärlich. Wie konnte etwas dargestellt werden, indem es nicht dargestellt wurde? Es war rätselhaft, aber es war digital. Und es hatte mit unserem Finger zu tun. Man konnte digitale Information mit einem Finger – lateinisch „digis“ – darstellen. Finger hoch: Eins. Finger runter: Null. Digital.
Auch was ein Medium ist, wussten wir. Ein Medium ist die Mitte. Die Mittte zwischen zwei Dingen, ein Träger von Jemandem oder von etwas, ein Mittler. „Medium“ hatte damals einen obskuren Unterton. Finger rauf, Finger runter – geschenkt. Aber Medium klang nach Geisterbeschwörung, nach halbgegrilltem Steak, nach Tabasco für Waschlappen. Das sollte so bleiben. Medium war halbgar und obskur. Kein guter Start für einen Begriff, in dem Fernsehen und Zeitungen Platz haben sollten, und auch noch Filme und Musik, Telefone und Computer und was die Weltraumindustrie noch an Zukünftigen in ihren Schubladen verstecken mochte.
Aus dem obskur-okulten Fingerzeigen und dem ungläubigen Staunen über elektronische Gehirne, die eine grössere Sardinenbüchse bis zum Mond steuern konnten, wurde bald handfester Alltag. Der erste digitale Freund, den wir hatten, hiess TI-30 und war ein goldbraun glänzender Taschenrechner von Texas Instruments, der – niemand nahm es wunder – aus dem Mondfahrerstaat Texas kam. Silicon Valley war da noch eine Pampa.
Kaum war das digitale Rechnen Teil unseres analogen Denkens, kaum war 12:30 dasselbe wie halbeins, schaffte Phillips die Schallplatte ab und ersetzte sie durch Karajans CD. Kaum zu glauben: Auch Jimi Hendrix, gerade noch auf einer zerkratzten Vinyl gehört, fidelte glasklar, ein wenig zu klar von der silbernen Scheibe. Voodoo Chile, Red House, Hey Joe: Alles in Eins und Null. Und so sollte es weiter gehen.
Ein Gerät nach dem anderen wurde digital. Die Telefontastatur, der Anrufbeantworter, das Autoradio, das Videoband, die Heimorgel. Alles eins oder Null, alles Zeigen oder nicht Zeigen, alles Medium. In der Mitte. Zwischen uns und wem anderen.
Und dann kam Apple und Microsoft, Quark-X-Press und Photoshop, die DVD, die Digitalkamera, die elektronische Motoreinspritzung, Lara Croft und Myst, Satelliten-Receiver und der Klingelton, CNN, das Internet und der Download. Die Volldigitalisierung der Welt.
Digitales Medium. Was war das schnell noch mal? Ach ja. Irgendwas in der Mitte, kurz nach der Mondlandung. Ein Zeigefinger und halbgare Gespräche mit Geistern.


 Das Wort Klima (τὸ κλίμα) ist ein altgriechischer Begriff, der vom Zeitwort klínein (κλίνειν) kommt. Es heisst soviel wie „neigen, biegen, krümmen”. Auch unser Wort “klein” stammt wahrscheinlich von einem ähnlich lautenden indoeuropäischen Wort ab. Die Krümmung, das sich biegen, das niederbeugen hat aber auch mit einem Möbelstück zu tun, dem Bett nämlich. Im Altgriechischen ist aus dem Verb klínein die kliniké (klΐnikέ), das „Lager, Bett“ geworden und aus klinikè téchne (κλινικὴ τέχνη) die „Heilkunst für Bettlägrige”, für Kranke – nichts weniger als die Medizin. Unser Wort Klinik kommt daher, über das lateinische clinice und das französische clinique – “die Anstalt zur Unterweisung im medizinischen Unterricht“.
Das Wort Klima (τὸ κλίμα) ist ein altgriechischer Begriff, der vom Zeitwort klínein (κλίνειν) kommt. Es heisst soviel wie „neigen, biegen, krümmen”. Auch unser Wort “klein” stammt wahrscheinlich von einem ähnlich lautenden indoeuropäischen Wort ab. Die Krümmung, das sich biegen, das niederbeugen hat aber auch mit einem Möbelstück zu tun, dem Bett nämlich. Im Altgriechischen ist aus dem Verb klínein die kliniké (klΐnikέ), das „Lager, Bett“ geworden und aus klinikè téchne (κλινικὴ τέχνη) die „Heilkunst für Bettlägrige”, für Kranke – nichts weniger als die Medizin. Unser Wort Klinik kommt daher, über das lateinische clinice und das französische clinique – “die Anstalt zur Unterweisung im medizinischen Unterricht“. Klima ist in Österreich aber noch in ganz anderem Zusammenhang in Erinnerung. Klima war der Name des neunten Bundeskanzlers der Zweiten Republik. Viktor Klima, Nachfolger von Franz Vranitzky amtierte drei Jahre lang am Ballhausplatz und ein paar Strassenzüge weiter als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. 2000 sollte ihn Wolfgang Schüssel als Bundeskanzler ablösen. Der Schwechater Klima, der vor seiner Politikerkarriere erfolgreicher Manager war, galt gemeinhin als konsensorientiert und war nicht gerade als Donnergott verschrien. Nach dem Scheitern von Koalitions-Verhandlungen mit der ÖVP verließ er die österreichische Politik und übernahm die Leitung der argentinischen Volkswagen-Niederlassung. Seit 2007 ist er Chef der gesamten Volkswagen-Niederlassung in Südamerika und Berater des argentinischen Präsidenten Nestor Kirchner. Sein Name Klima nicht aus dem griechischen, sondern aus dem tschechischen. Dort ist Klima (wie die ähnlich lautenden Namen Klimt und Klimek) die Verkleinerungsform des lateinischen Vornamens Clemens. Was soviel heisst wie mild, gnädig, sanftmütig. Kein falscher Name also für einen gutfrisierten Schönwetterkanzler.
Klima ist in Österreich aber noch in ganz anderem Zusammenhang in Erinnerung. Klima war der Name des neunten Bundeskanzlers der Zweiten Republik. Viktor Klima, Nachfolger von Franz Vranitzky amtierte drei Jahre lang am Ballhausplatz und ein paar Strassenzüge weiter als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei. 2000 sollte ihn Wolfgang Schüssel als Bundeskanzler ablösen. Der Schwechater Klima, der vor seiner Politikerkarriere erfolgreicher Manager war, galt gemeinhin als konsensorientiert und war nicht gerade als Donnergott verschrien. Nach dem Scheitern von Koalitions-Verhandlungen mit der ÖVP verließ er die österreichische Politik und übernahm die Leitung der argentinischen Volkswagen-Niederlassung. Seit 2007 ist er Chef der gesamten Volkswagen-Niederlassung in Südamerika und Berater des argentinischen Präsidenten Nestor Kirchner. Sein Name Klima nicht aus dem griechischen, sondern aus dem tschechischen. Dort ist Klima (wie die ähnlich lautenden Namen Klimt und Klimek) die Verkleinerungsform des lateinischen Vornamens Clemens. Was soviel heisst wie mild, gnädig, sanftmütig. Kein falscher Name also für einen gutfrisierten Schönwetterkanzler. Das Wort ‘Glaube’, verwandt mit dem Begriff “geloben”, hiess im frühen Mittelalter ‘ga-loubjan’ und hatte die Bedeutung “vertrauen”. Wem oder was wurde vertraut? Gott, oder gar Göttern? Weit gefehlt. Wenn wir das Wort ‘Glaube’ ins Mittelalter zurückwerfen, zerfällt es in Begriffe, die heute ge-lauben, Ge-Laube, Ge-Lobe heissen müssten. Hat der Glaube also mit dem Lob zu tun? Die Antwort ist kurz und simpel – Ja. Der Glaube ist – sprachlich gesehen eine Art Lob. Klingt seltsam, ist es auch. Denn das Lob ist etymologisch betrachtet keine Belohnung sondern ein Köder. Noch heute werden Preise, Wettbewerbe, Stellen ausgelobt.
Das Wort ‘Glaube’, verwandt mit dem Begriff “geloben”, hiess im frühen Mittelalter ‘ga-loubjan’ und hatte die Bedeutung “vertrauen”. Wem oder was wurde vertraut? Gott, oder gar Göttern? Weit gefehlt. Wenn wir das Wort ‘Glaube’ ins Mittelalter zurückwerfen, zerfällt es in Begriffe, die heute ge-lauben, Ge-Laube, Ge-Lobe heissen müssten. Hat der Glaube also mit dem Lob zu tun? Die Antwort ist kurz und simpel – Ja. Der Glaube ist – sprachlich gesehen eine Art Lob. Klingt seltsam, ist es auch. Denn das Lob ist etymologisch betrachtet keine Belohnung sondern ein Köder. Noch heute werden Preise, Wettbewerbe, Stellen ausgelobt. Der unsterbliche Porschefahrer James Dean ist einer, die Präsidentengeliebte Marilyn Monroe ebenso wie das sagenumwobene Troja, das mysteriöse Atlantis und die Katastrophe aller Katastrophen, die Sintflut: Mythen sind das Salz der Geschichte. Mythen handeln von Göttern und Unglück, Heldentum und Untergang.
Der unsterbliche Porschefahrer James Dean ist einer, die Präsidentengeliebte Marilyn Monroe ebenso wie das sagenumwobene Troja, das mysteriöse Atlantis und die Katastrophe aller Katastrophen, die Sintflut: Mythen sind das Salz der Geschichte. Mythen handeln von Göttern und Unglück, Heldentum und Untergang.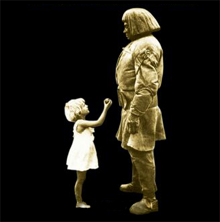 Als der Religionshistoriker Gershom Scholem, Inhaber des Lehrstuhl zur Erforschung jüdischer Mystik an der Universität Jerusalem hörte, dass 1965 im Weizmann-Institut für Wissenschaften im israelischen Rehovot ein hochkomplexer neuer Großrechner in Betrieb genommen werden sollte, schlug er vor, diesen „Golem I“ zu nennen. Scholem, 1897 in Berlin geboren, gilt als Wiederentdecker der Kabbala, jener mystischen, meist mündlich weitergegebenen jüdischen Geheimlehre. Mit der Geschichte vom Golem, des ersten Roboters der Neuzeit, den der legendäre Prager Rabbi Löw zur Abwehr antisemitischer Zeitgenossen aus einem Klumpen Ton geformt haben soll, war Scholem aus Mitteleuropa vertraut.
Als der Religionshistoriker Gershom Scholem, Inhaber des Lehrstuhl zur Erforschung jüdischer Mystik an der Universität Jerusalem hörte, dass 1965 im Weizmann-Institut für Wissenschaften im israelischen Rehovot ein hochkomplexer neuer Großrechner in Betrieb genommen werden sollte, schlug er vor, diesen „Golem I“ zu nennen. Scholem, 1897 in Berlin geboren, gilt als Wiederentdecker der Kabbala, jener mystischen, meist mündlich weitergegebenen jüdischen Geheimlehre. Mit der Geschichte vom Golem, des ersten Roboters der Neuzeit, den der legendäre Prager Rabbi Löw zur Abwehr antisemitischer Zeitgenossen aus einem Klumpen Ton geformt haben soll, war Scholem aus Mitteleuropa vertraut.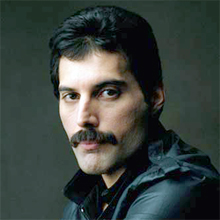 Der Chef aller Märkte, ob Wochenmarkt oder Wallstreet heisst nicht Nasdaq, nicht Nikkei, nicht Dax, Hang Seng oder Dow Jones. Er trägt weder Standlertracht noch Brookerkluft sondern schlicht und einfach gar nichts. Der oberste Marktschreier ist nackt bis über die Augenbrauen. Auf dem Kopf trägt er den Petasos, einen schlappkrempigen Seppelhut aus Filz. Aussergewöhnlich an der Bauernmütze sind allenthalben die Asterixflügel.
Der Chef aller Märkte, ob Wochenmarkt oder Wallstreet heisst nicht Nasdaq, nicht Nikkei, nicht Dax, Hang Seng oder Dow Jones. Er trägt weder Standlertracht noch Brookerkluft sondern schlicht und einfach gar nichts. Der oberste Marktschreier ist nackt bis über die Augenbrauen. Auf dem Kopf trägt er den Petasos, einen schlappkrempigen Seppelhut aus Filz. Aussergewöhnlich an der Bauernmütze sind allenthalben die Asterixflügel. Das Wort ist hart wie Stahl, flüchtig wie Nebel. Macht. Es riecht nach Lederfauteuils hinter dicken Polstertüren, nach Managerschweiss unter Armanituch, nach der süssen Würzigkeit echter Cohibas und dem Nussfurnier teurer Limousinen. Sein Klang oszilliert zwischen dem Seufzen einer unterschreibenden Mont-Blanc und dem animalischen Brüllen eines startenden Firmenjets. Macht kann vererbt sein, erkämpft, verteilt oder konzentriert. Sie kann Bürde sein und Droge. Jeder kennt sie. Viele fürchten sie, die meisten hätten sie gerne, und allen ist klar: Macht kommt vom Machen.
Das Wort ist hart wie Stahl, flüchtig wie Nebel. Macht. Es riecht nach Lederfauteuils hinter dicken Polstertüren, nach Managerschweiss unter Armanituch, nach der süssen Würzigkeit echter Cohibas und dem Nussfurnier teurer Limousinen. Sein Klang oszilliert zwischen dem Seufzen einer unterschreibenden Mont-Blanc und dem animalischen Brüllen eines startenden Firmenjets. Macht kann vererbt sein, erkämpft, verteilt oder konzentriert. Sie kann Bürde sein und Droge. Jeder kennt sie. Viele fürchten sie, die meisten hätten sie gerne, und allen ist klar: Macht kommt vom Machen. Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
Als ich ins Gymnasium ging, in den Siebziger Jahren, in Wien, war alles noch anders. Analog. Auch wenn das damals niemand so nannte. Alles war analog. Radios hatten eine Röhre, Musik kam von zerkratzen schwarzen Scheiben und mathematische Berechnungen fanden auf einem seltsamen Gerät statt, das sich Rechenschieber nannte. Elektronengehirne, gross wie Einfamilienhäuser, waren zwar schon aus den Science-Fiction-Büchern ausgebüchst und hatten Amerikaner gerade erfolgreich zum Mond und wieder zurück gebracht, aber was ein Computer sein sollte, wusste damals noch niemand. Computergenies beschäftigten sich im Spätnachkriegs-Österreich nicht mit extraterrestrischen Expeditionen, sondern ausschließlich mit „EDV“, elektronischer Datenverarbeitung.
 Arm ist ein hochkomplexes Wort. Das gilt für den Arm, jenen Körperteil, der unser wichtigstes Werkzeug, die Hand trägt gleichermassen wie für “arm” das Gegenteil von “reich”.
Arm ist ein hochkomplexes Wort. Das gilt für den Arm, jenen Körperteil, der unser wichtigstes Werkzeug, die Hand trägt gleichermassen wie für “arm” das Gegenteil von “reich”.