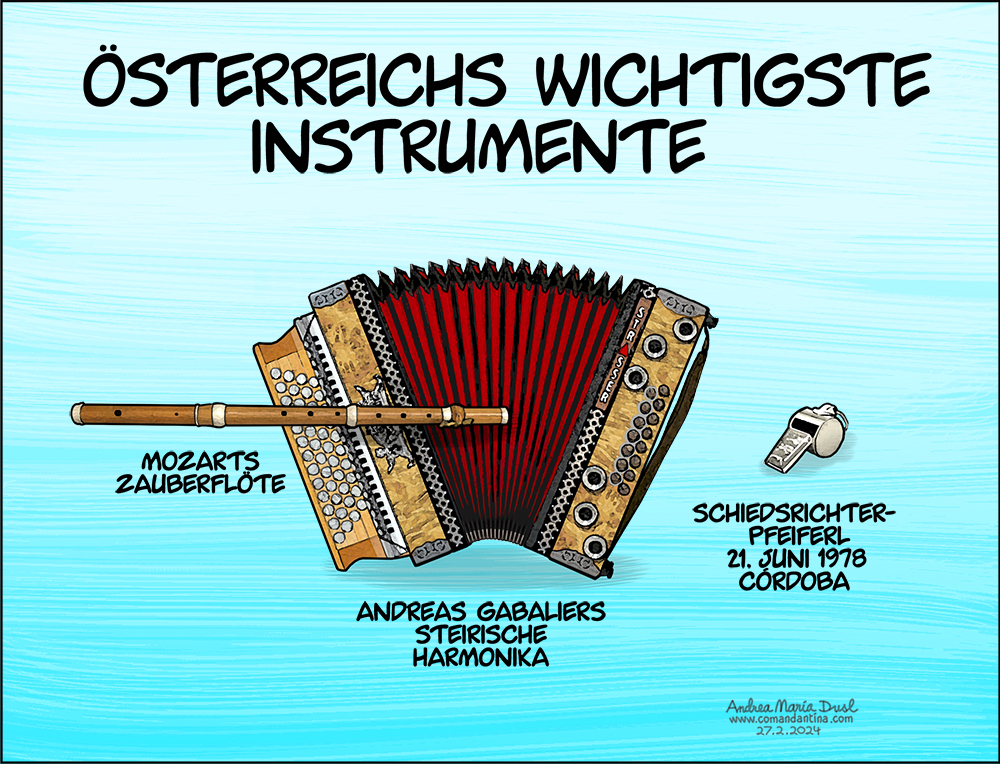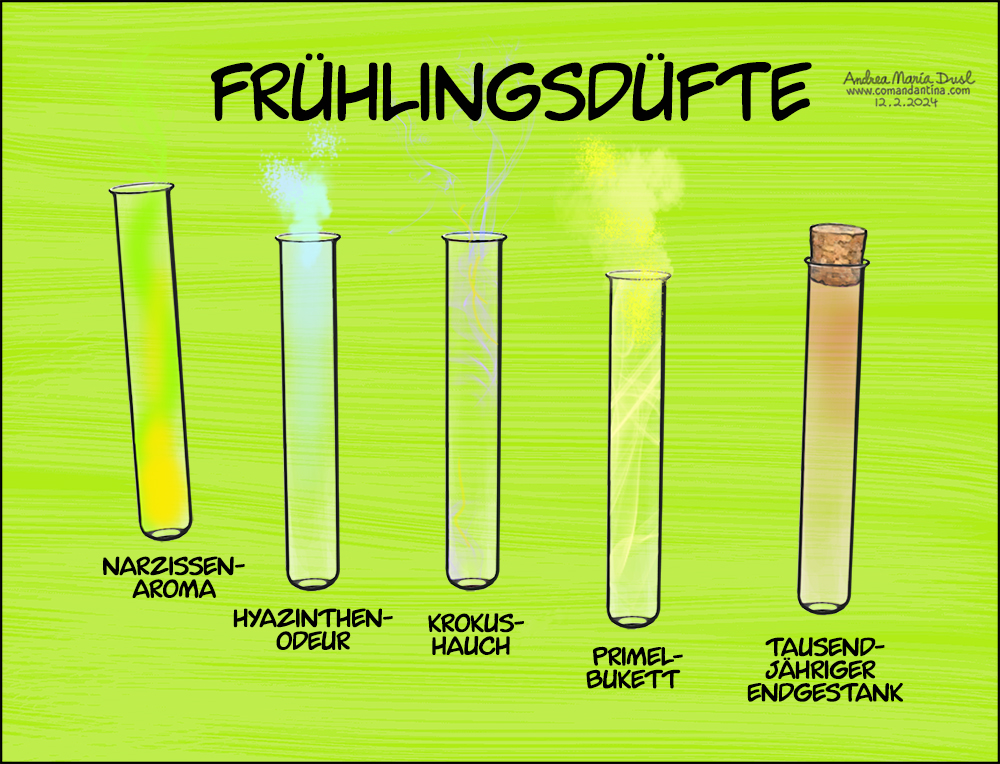Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 12/2024 vom 20. März 2024
Liebe Frau Andrea,
vor einem halben Jahrhundert war der März im Mostviertel anders als heutzutage noch ein Wintermonat. Trotzdem jagte der Schreiber dieser Zeilen bereits vor Ostern auf kaum ausgeaperten Wiesen dem runden Leder oder Plastik nach. Die Oma warnte die erhitzten und daher leicht gewandeten Fußballer vor Verkühlung und Ärgerem: „Euch wird noch das Miaznkeuwi (März-Kalb) holen!“ Warum interessierte sich das Kalb für uns und wohin wollte es uns bringen?
Danke für späte Aufklärung
Robert Hülmbauer, Mostviertel
Lieber Robert,
aus der Erfahrung erhöhter Erkältungsgefahr im trügerisch sonnigen März und den anekdotischen Evidenzen, dass in diesem Monat viele alte oder chronisch kranke Menschen starben, hat der Volksmund in unseren Breiten eine Warnung vor einem immaginären tiergestaltigen Dämon gemacht. Erkrankte früher jemand im März an einer starken Verkühlung, oder starb, sagte man: „den hots Mirzenkaibl ghoit“ (den hat das Märzenkalb geholt).
Die Warnungen vor dem frischgeborenen und jungen Rind gehen auf vorchristliche, in ganz Europa verbreitete Mythologien zurück, die von der Forschung als Korngeister bezeichnet werden. Auch andere Tiere zogen durch die Felder. Strich etwa der Wind durchs Getreide, hieß es, der Wolf ginge durch. Mit der Erntezeit auf den Kornfeldern verband die bäuerliche Gesellschaft die Vorstellung, ein altes (unsichtbares, weil geistwesenhaftes) Rind verbleibe am Feld und bewache dieses. Mit dem Wiedererstarken der Natur im Frühling trat an dessen Stelle ein junges Rind, das besagte Märzenkalb. Als energetischem, wilden jungen Wesen wurden ihm dämonische Eigenschaften zugesprochen.
In der Gegend von Gaming, das ebenfalls in dem von Ihnen erwähnten niederösterreichischen Mostviertel liegt, erzählte man von den Kindern der Sagengestalt Perscht (Percht), von Gagarauntzl, Thomaszoll, Zudarn, Zadarwaschl, und dem gefährlichen Märzenkalbl. Ähnlich dem Kinderschreck Habergeiß (auf der der Teufel reitet) war das Märzenkalb ein erzieherisches Drohgespenst, das unfolgsame Kinder fraß oder mitnahm.
Mit oder ohne Fußball.