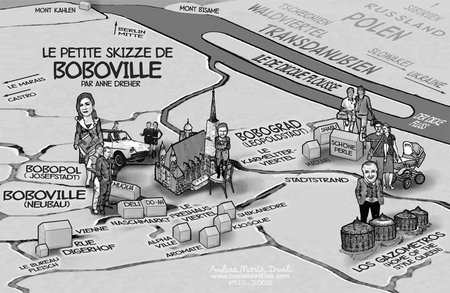„Die ,Negerlein‘ im heißen Afrika der Heiden und der wilden Tiere, so erzählten uns die Schwestern, befänden sich in den Fängen des Satans, der ihnen nicht nur den falschen Geburtskontinent, sondern auch die falsche Hautfarbe mit auf den Lebensweg gegeben habe.“ Aus meinem Roman Boboville. Vorabdruck in Die Presse – spectrum vom 19.09.2008
Präsentation und Lesung von Boboville: 24.9., 19h im Schikanederkino, Wien 4., Margaretenstrasse 24.
Weitere Lesung am 27.9., 21h im Loisium Langenlois.
……………………………..
Buch bestellen oder Dusl buchen? Hier geht’s zur —>Residenz-Homepage von Boboville.
 Weiter gegen den Wald, der hier einmal stand, jenseits von Boboville, im Dunkel der Provinz, da lag unsere Schule. Es war keine normale Schule. Ganz im Gegenteil, es war eine ganz und gar unnormale, absonderliche, eine ganz und gar abscheuliche Schule. Die Private Volksschule des Vereins der Schulschwestern vom 3. Orden des hl. Franziskus für Knaben und Mädchen mit Öffentlichkeitsrecht. Sie war das Gegenteil vom Bonbongeschäft. Aber für die Genese Bobovilles, für die Aufklarung der Andreamaria waren die Vorgänge in ihrem Inneren gewiss mindestens so wichtig. Denn wo Licht ist, so lernten wir es im Religionsunterricht beim Herrn, den wir den Herrn Katechet nannten, ist immer auch der Schatten. Und es war viel Schatten im Gebäude Leopoldsgasse 1a.
Weiter gegen den Wald, der hier einmal stand, jenseits von Boboville, im Dunkel der Provinz, da lag unsere Schule. Es war keine normale Schule. Ganz im Gegenteil, es war eine ganz und gar unnormale, absonderliche, eine ganz und gar abscheuliche Schule. Die Private Volksschule des Vereins der Schulschwestern vom 3. Orden des hl. Franziskus für Knaben und Mädchen mit Öffentlichkeitsrecht. Sie war das Gegenteil vom Bonbongeschäft. Aber für die Genese Bobovilles, für die Aufklarung der Andreamaria waren die Vorgänge in ihrem Inneren gewiss mindestens so wichtig. Denn wo Licht ist, so lernten wir es im Religionsunterricht beim Herrn, den wir den Herrn Katechet nannten, ist immer auch der Schatten. Und es war viel Schatten im Gebäude Leopoldsgasse 1a.
Auch dieses hatte seine Richtigkeit. Ein Gebäude wie das der Schulschwestern konnte nur die Hausnummer 1 tragen. Nichts anderes wäre denkbar gewesen als diese Zahl. Und um die Gelegenheit zu nutzen, diese Erstheit noch zu unterstreichen, fügte das Schulschwesternkommando auch noch den Buchstaben „a“ an. Jedes Gebäude, das diese Nummer hätte unterschreiten wollen, hätte tief in die Untere Augartenstraße hinein bauen müssen und sich Leopoldsgasse römisch eins groß A nennen müssen. Leopoldsgasse IA. Eventuell hätte ein solches Gebäude der Schulschwesternburg den Eminenzrang abgelaufen. Jenseits dieser Privatüberlegungen hatte die Hausnummer „1a“ etwas zutiefst Schulisches. Klar, dass ich eine Klasse besuchte, deren Kennzahl ebenfalls „1a“ war.
Als noch viel Schatten war im Dunkel der nonnengeführten Schulburg, wurde viel mit Licht hantiert. Es wurde Licht ins Dunkel gebracht. Mit Kerzen, schirmlosen Hundert-Watt-Birnen und mit dem Feuer der Spende. Erinnern wir uns doch, wie das ist in Schnitzelland. In heiligen Zeiten, meist ist das der Advent, die Zeit der Besinnung, gefällt sich Boboville darin, Gnade vor Unrecht walten zu lassen und den einen oder anderen Schein zu spenden. Im Kerzenlicht der Betroffenheitsgalas werden Spenden lukriert, dass sich die Konten biegen. Wie das geht, lernten wir 1968. In der Schule. Während anderswo die Pflastersteine aus dem Boulevard gerissen wurden. In Saint-Germain-des-Prés. Auf der Wiese des Widerstands. Wie man Spenden aus den Herzen schneidet, lernten wir in der Rue Léopold. In keiner Schule Bobovilles lernte man das Spenden besser als in der Volksschule des Vereins der Schulschwestern vom 3. Orden des hl. Franziskus für Knaben und Mädchen mit Öffentlichkeitsrecht.
Ich gebe nichts. Außer Roma-Musikern, in denen ich aus familiären Gründen meinesgleichen sehe, gebe ich nichts, nie, niemandem, außer meinen Freunden, den Musikern. Die Spende ist das Böse. Zwischen mir und der Spende steht die Unmöglichkeit. Schon das Wort löst in mir Beklemmungen aus. Die Abneigung gegen das Spenden überfiel mich in der Volksschulklosterburg. Die Schwestern, in deren Obhut ich mich befand, weil mein Vater am Auftrag zu einem Kirchenbau bastelte, die Schwestern in der Leopoldsgasse 1a, hatten ein ausgeklügeltes Ritual entwickelt, um an Geld zu kommen. Zu allen heiligen Zeiten, die riefen sie aus, wie ihnen das katholenkalendarisch passte, wurde der „Negerlein“ gedacht. Die „Negerlein“ im heißen Afrika der Heiden und der wilden Tiere, so erzählten uns die Schwestern, befänden sich in den Fängen des Satans, der ihnen durch eine Gnadenlosigkeit ohnegleichen nicht nur den falschen Geburtskontinent, sondern auch die falsche Hautfarbe mit auf den Lebensweg gegeben habe. Diese tragische Konstellation gelte es zu lindern. Direkt in die Hölle kämen die armen „Negerlein“, wenn nicht geholfen würde. Gestorben würde schnell in Afrika. Und wenn wir tatenlos zusähen, dann wäre alles verloren.
Ein „Negerlein“ nach dem anderen würde in den Höllenschlund hinabsausen, und was und wie es sich da abspielte, sollten wir uns lieber nicht vorstellen. So war das, in der dunklen Abgeschiedenheit der Leopoldsgasse 1a. Wir müssen helfen, Schwester Benedicta, rief es in Andrea Maria in der ersten Reihe, Birgit in der zweiten war den Tränlein nahe, und Silvia mit zwei i ohne Ypsilon neben mir saß stumm vor Schreck beim Gedanken an die unaussprechliche Satansgewalt an afrikanischen Kindern. Wie können wir helfen, schrien wir im innerlichen Chor, hätten wir tatsächlich geschrien, wäre es in einer Lautstärke gewesen, mittels derer im Urania-Kasperltheater die Prinzessin vor dem Krokodil gewarnt wurde. Aber tatsächliches Schreien war im Schulschwesternbunker nicht erlaubt. Nur das innerliche Schreien, der stumme Schrei der Seele, der hatte Gottes Segen.
Ganz einfach könnt ihr helfen, antwortete Schwester Benedicta mit ihrer weihrauchbelegten Stimme, und ihr nacktes Gesicht glättete sich unter dem schwarzen Schleier: Ihr müsst ein Negerlein taufen lassen. Denn nur wenn es getauft sei, so verkaufte sie uns den Deal, nur wenn es gekauft sei, misslänge es dem Satan, seine schmutzigen Krallen nach dem unschuldigen Heidenkindlein auszufahren. Gekauft, sagte die haarlose Benedicta, so wahr dieses Buch hier Bobovilleheißt. Nur wenn einer von den katholischen Missionaren, den Helfern und Heiligmäßigen der päpstlichen Armee, die Erbsünde von ihnen abwüsche, wären sie rein und fein für den Erlöser, so dieser sich anschickte, eines der armen „Negerlein“ zu sich zu rufen. Und der Erlöser rief gerne und oft. Das war Teil seiner Agenda. „Negerlein“ zu sich rufen.
Ob man nicht Suppe schicken sollte oder Semmeln, wollten wir wissen, und Schulbücher, ja vielleicht Spielsachen? Mehlspeisen? Neinneinnein, grimmten die Haarlosen, all das wäre nichts, ja Hohn, wenn es Ungetauften dargebracht würde. Denn nichts, nichts und aber nichts wäre so heilbringend wie die Taufe. Ohne Taufe wäre das Heil hinüber. Und die Taufe, so versprach uns Schwester Benedicta in einem feierlichen Tonfall, die Taufe könnten wir ihnen bringen. Wir. Niemand anderer. Nicht der Papst, nicht der Herr Katechet, nicht die Schwester Direktor, die Schwester Treppe oder die Schwester Pforte, nicht Bürgermeister Marek, nicht die Frau vom Papiergeschäft. Wir.
Hundert Schilling koste die „Negertaufe“. Hundert wohlfeile Schilling, so viel wie hundert Bensdorp-Schokoladeriegel, so viel wie tausend Stollwerck-Zuckerl. Unermesslich wohlfeil für eine Gnade, die das Höllentor verschließen konnte. An jenem Tag, dem ersten dieser Art, den ich erinnere, gingen einunddreißig Schulkinder der 1a in der Schule der Schulschwestern in der Wiener Leopoldsgasse nach Hause und machten ihren Eltern klar, dass, wenn morgen nicht alle mit Hundertschillingscheinen in der Klasse erschienen, all die „armen Negerlein“ mit ihren „schwarzen Häuten“ und kurzärmligen Hemden vom Satan persönlich verspeist würden. Ungetauft und nach ewig langem Rösten im Fegefeuer der Versäumnisse.
So kam es, dass am nächsten Tag dreißig Wiener Schulmädchen, vom Gedanken an die Rettung von einunddreißig „Negerlein“ erfüllt, dreißig Kuverts mit Hundertschillingscheinen übergaben und mit der Kenntnis des Ausdrucks „Gutes Gewissen“ belohnt wurden. Klara Polacek, die Tochter vom Fleischhauer am Karmelitermarkt, hatte ein Kuvert mit 5 Hundertern mitgebracht – eine geradezu überirdische Christentat, wie Sr. Benedicta sich bemühte zu erklären. Einige Monate später, der Krampus war ins Land gezogen, das Christkind, Frau Holle und auch die Heiligen Drei Könige, brachte Sr. Benedicta Nachricht aus Afrika: Bilder unserer Taufkinder. Der Glaser in der Leopoldsgasse hatte sie zwischen zwei postkartengroße Glasscheiben gepresst und mit rosafarbenem, mit korngelbem, mit giftgrünem Textilband eingerahmt. Fünfunddreißig verglaste Selige. Das waren sie, die Spätgetauften, die „Negerlein“, die von uns Geretteten! Wir hatten Tränen in den Augen und Christus im Herzen. Und das Gute Gewissen des gefälligen Glaubens.
Bis mein Bruder Christian, wir nennen ihn Kai, im übernächsten Jahr mit dem Bild seines „Negertäuflings“ nach Hause kam. Und seltsam: Der Porträtierte sah genauso aus wie meiner, und hätten wir fotografische Zusammenhänge benennen können, hätten wir gesagt: Das ist ein Abzug vom selben Negativ. Weil auch unbenennbare Zusammenhänge neugierig machen, kletzelten wir die korngelben Textilrahmen entzwei und verglichen die beiden Bilder miteinander. Sie waren identisch. Emanuel Izuagha und Markus Adegboye glichen einander wie ein Ei sich selbst. Auf der Rückseite trugen beide Bilder den gleichen Stempel: Foto Hubalek, Favoriten.
Seither hege ich berechtigte Zweifel daran, dass auch nur irgendein Teil jener Summe, die wir jahrein, jahraus in das Taufen dunkelhäutiger Heidenkinder investierten, dazu diente, den nach dem Seelenheil Ungetaufter gierenden Höllenschlund zu verriegeln. Im Garten meiner Erinnerung riechen die Wörter Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Spende nicht nach Rosen, sondern nach dem taubenbeschissenen Efeu im Hinterhof der Schulschwestern vom franziskanischen Gnadenwohl.
Kategorie: Boboville
Texte und Hinweise zum Roman „Boboville“. Information zu Lesungen und Rezensionen.
Boboville ::: Vorabdruck im „Falter“
 In 25 Tagen ist es soweit. In 25 Tagen erscheint mein Roman Boboville. Bei Residenz. Das sagt man so. Erscheint bei Residenz. Die Präsentation wird im Schikanederkino stattfinden, am 24ten September, um 19 Uhr. Es wird leiwand werden in dem kleinen Kino. Aber ich lese noch wo anders. Ich werde viel lesen aus Boboville. —> Hier geht’s zu den Terminen.
In 25 Tagen ist es soweit. In 25 Tagen erscheint mein Roman Boboville. Bei Residenz. Das sagt man so. Erscheint bei Residenz. Die Präsentation wird im Schikanederkino stattfinden, am 24ten September, um 19 Uhr. Es wird leiwand werden in dem kleinen Kino. Aber ich lese noch wo anders. Ich werde viel lesen aus Boboville. —> Hier geht’s zu den Terminen.
Buch bestellen oder Dusl buchen? –>Hier geht’s zur Residenz-Homepage von Boboville.
Mein Lesefreund Klaus Nüchtern, der Mann mit dem ich nach Poughkeepise fahre, um zu lesen, wenn wir lesen, gemeinsam, Klaus Nüchtern hat eine Episode aus Boboville als Vorabdruck in Falter 35/2008 gehängt. Hier nun ein erster Blick auf die Geschichten in Boboville:
Swuh, Newauuah, Rahr
Warum es so ist, weiß ich nicht, aber als Kind, so viel ist sicher, hat man einen schlechten Musikgeschmack. Um genau zu sein, und ich spreche hier von mir, hatte ich überhaupt keinen Musikgeschmack. Die Reste von irgendwas, was mit Musik zu tun hatte, hatten mir die Nonnen abgewöhnt, die Leopoldsgassennonnen, wenn ich am Klavier klimperte bei ihnen, um das Etüdenheft abzuarbeiten, dann war das schon nicht so funky, schwarze Musik, das sollte ich später lustvoll lernen, hörte sich anders an. Die Nonnen jedenfalls groovten nicht, niemals taten sie das, indes sie wichsten mir mit dem Rohrstab auf die Finger, Bambus zu ihm zu sagen hatten die bösen Tanten nicht den Mut, Bambus hätte ja Schwanz heißen können oder Stängel oder Penis, oh Gott. Als ob Rohrstab nicht auch schon Penis hieße.
Musik tat mir weh, und der Nonnen Schläge hatten Klavier und Klang auf bestialische Weise mit dem Thema Schmerz verschweißt. Es sollte viele Jahre dauern, bis das jemand wieder lösen konnte. Freddie Mercury hieß das Wesen, es war das Gegenteil jeder Nonne, gewiss war er das und darum liebte ich ihn vom ersten Augenblick an. Er trat in mein Leben zur Skikurszeit im Bergesland, wie war das, den Tag hindurch ödes Laufen am Hang, Rutschen in weißen Wiesen, kalte Finger und Schmerzen im Schuh. Aber am Abend, da war Party. Zwölf waren wir und wir knospten und wir konnten schon küssen, wenngleich es verboten war. Wer küsste, fuhr heim, sagten sie, die Sportlehrer, wo sie es doch selber miteinander trieben, wir hatten ihn gesehen, den Drohbard, die Zunge klebte ihm am Gaumen, seine Hose warf sich nach vorn, hatten gesehen, wie der Lehrer ins Zimmer seiner Kollegin gehuscht war. Hatten gelauscht, hatten das Stöhnen der Turnlehrerin vernommen und sein tierisches Juchzen und das metallische Quietschen der Betteinsätze.
Küssen war nicht und sonst auch nichts, bei uns jedenfalls nicht, aber Hopsen war und Party, mit Apfelsaft im Glas und Strähnen in den Pupillen. Und dann kam es in mich, das Lied, das den Schmerz radierte, ein hagerer Beau klimperte es, auf einem Bechstein. Noten wie aus dem Etüdenheft, nur schöner, viel schöner, jenseitig schön und ohne Rohrstäbe war es und ohne Nonnengift. So geschah es, dass ich die Musik wieder in mein Herz ließ. „Killer Queen“ hieß das Lied, und um es zu verstehen, habe ich mir nach dem Skikurs ein Wörterbuch gekauft. Moët kam vor, was war das bloß, und Marie Antoinette, Gunnenpuder und Gelatine, Chruschtschow und Kennedy, Kaviar und Zigaretten, Dynamit und ein Laserstrahl, und nie, sang Freddie mit der Stimme im Falsett, behielt sie dieselbe Adresse, sang er von Greta? Parfum aus Paris, ja so war sie, verspielt wie eine Pussikatze. She’s all out to get you, wanna try? Nein, wollte ich nicht, ganz sicher nicht, probieren wollte ich das nicht, ich wollte es sein, sofort und für immer, Komplikationen inbegriffen.
Aber da war ja noch was, noch was hinter dem Freddiegeklimper, ein singender Ton. Es klang wie eine Geige, aber es war keine, dann klang es wie ein Saxofon, aber das war es auch nicht, und ein Sündeseiser, so sagten sie, war es auch nicht, denn das stand auf der Queenplatte, ich hatte mittlerweile eine, keine Synthesizer stand da, no synthesizers, und das musste doch stimmen. Was war das, hinter den Freddietastenklängen, hinter dem lieblich perlenden Bechstein, war das eine Gitarre, die der hagere Lockenkopf da auf den Saiten kitzelte?
Ich fragte Harry Hassler, einen Mitschüler aus der Parallelklasse, der einzige, der lange Haare trug wie die Wesen von Queen, der konnte so etwas wissen, der musste es wissen, der hatte seine Gefahrhaare nicht ohne Grund. Aber sicher, wieherte Hassler, das ist der Breihenmeh, er hat eine elektrische Gitarre, kleines Mädchen. Elektrische Gitarre, was ist das? Gibt es nicht bei uns, gibt es in Carnaby. Eine Gitarre, die man an den Strom steckt, mit einem Kabel, dummes Kind, und die macht dann diese Töne. Wie geht das, wo steht das? Steht in Bravo, wieherte Hassler und wedelte mit seinen honigfarbenen Locken, die Saiten werden elektrisch und man muss sie nicht zupfen, man legt den Finger auf die Saite und es macht Swuh. Wo bekomme ich so eine Gitarre?, fragte ich Hassler. In Carnaby, sag ich doch, hab ich gelesen, sagte Hassler gelangweilt, gibt es ein Geschäft.
Es war um mich geschehen. Carnaby wurde meine Sehnsucht. Die Stadt mit Breihenmehs Gitarre. Hinter dem Wasser, gut, dass wir Englisch lernten, man würde mich verstehen, eines Tages im Elektrogitarrengeschäft. Das war nun mein Plan, einmal ins Elektrogitarrengeschäft zu kommen, in Carnaby, hinter dem Wasser und die Breihenmehgitarre zu kaufen, zu kaufen, zu haben, und aus ihr die Swuhs und Uahs und Newauuahs zu locken, die so süß und schön klangen, so hurtig und bizarr, so außerirdisch und fern. Swuh, Newauuah, Rahr.
Harry Hassler, er wieherte, wenn er lachte, wurde mein Freund, mein Berater, mein Intimus, mein Kamerad. Er durfte mich anstrahlen und wiehern, wann er wollte, seine fiebrigen Witzchen erzählen und mich auf den Mund küssen und meine Hand halten und rot werden, aber er musste mir alles erzählen, alles, was er wusste, erzählen, sobald er es erfuhr, alles über die elektrische Gitarre. Das war zu einer Zeit, als die Bobos noch in der Erde staken wie Spargelspitzen im Furchendamm. Es gab keine Handys, es gab kein Internet, die Computer waren so groß wie Bungalows und Taschen waren aus Leder gemacht und nicht aus Lastwagenplanen. Musik wurde in Carnaby gemacht, von Leuten mit Frisuren so groß wie Kleinplaneten und Sohlen von der Höhe einer Hochzeitstorte. Es war eine coole Zeit.
Und sie dauerte ewig. Denn es war eine langsame Zeit. Das Schnellste, was es zu dieser Zeit gab, war die Saturn V. Die Rakete, mit der man Menschen zum Mond brachte. Minuten dauerte es, bis sich der Riesenspargel gegen die Schwerkraft gestemmt und ein paar Etagen an Höhe gewonnen hatte. Eine coole Zeit. Ich mochte sie. Die Zeit vor den Schulterpolstern, die Zeit vor den Sicherheitsnadeln, die Zeit vor dem Boboismus. Eine Zeit der unzelebrierten Langsamkeit. Am Gymnasium, wo Harry Hassler um mich herumtanzte und wieherte, gegenüber vom Chemischen Institut, in der Gasse, die nach einem gesunkenen Schiff benannt war, da lehrten sie Sanskrit. Latein, Griechisch, Sanskrit, das war schon cool. Und langsam. Daran konnte man sich anhalten, am Rausch der Langsamkeit. Nur eines fehlte mir zum Glück. Die schönen Töne aus der Breihenmehgitarre. Die Stromgeige aus Carnaby musste her, Harry Hassler war gefordert.
Und dann, eines Tages, wieherte es und Harry Hassler sagte, die Messe, die Messe käme in die Stadt, hinten am Fluss, wo die Hallen sind, die große internationale Messe, sie käme. Was kommt sie, wie kommt sie?, fragte ich Hassler, sein Haarstroh wogte vor Freude. Die Messe, dort, wo es alles gab, das Neueste, Traktoren und Tonbandmaschinen, einfach alles, Transistorradios und Tastentelefone, Torsionsstäbe und Tischventilatoren. Und haben sie die Breihenmehgitarre? Vielleicht, sagte Hassler, schon möglich, man wird sehen. Und gehen wir hin, fändest du den Stand? Aber sicher, sagte Hassler, kein Problem, ich finde den Stand, aber nur, wenn du mit mir schwimmen gehst. Mit dir schwimmen, warum? Um zu üben. Was musst du üben?, sagte ich. Üben den Kopfsprung, sagte Hassler, im Schwimmbad, du musst. Du musst mir zusehen, ob mir der Kopfsprung gelingt, ob er gut aussieht. Und dafür werde ich auf die Messe gehen mit dir.
Können wir nicht auf die Messe gehen so? Ohne Bad, ohne springen? Neinneinneinnein, sagte Hassler, der Kopfsprung, ich brauche dich. Du musst ihn betrachten und mich lehren, wenn ich ihn falsch mache oder hässlich, dann musst du mir sagen, was falsch war und warum, und wenn er gelang, der Sprung, musst du klatschen und jubeln, ich brauche dich, ja?
Und dann eines Tages, bald war es so weit, trafen wir uns, vor dem Bad, das Hallenbad, unten am Fluss, auf der Bobovilleinsel, es war groß und neu und warm und es brannte in der Nase. Darum mochte ich es nicht, es machte die Haare nass und es brannte in der Nase, hätte ich es gewusst, ich hätte gesagt, es sei das Chlor, aber ich dachte, es läge an meiner Nase. Ich mochte das Bad nicht, man konnte mich sehen, wie nackt ich war, das war’s, was der Hassler ja wollte, das war sein Preis, dafür, dass er mit mir zur Messe gehen würde, die Breihenmehgitarre suchen, meinen Traum. Hassler wieherte mehr als sonst, als wir uns trafen hinter den Duschen, sein Haar hatte er unter einer Haube verborgen, schwarz war sie, durch die Mitte zog ein weißer Streifen.
Hassler sah aus wie ein Geier mit ihr. Sein Höschen war eng und geblümt, nie werde ich den Anblick vergessen. Ich schlüpfte ins Wasser und lobte den dünnen Kerl, wenn er, verboten war es, vom Beckenrand ins Wasser sprang wie ein taumelnder Frosch. Kopfüber, mit dem weißen Scheitel voran. Schneller, trieb ich ihn an, du musst dich mehr biegen, und schöner musst du sein, die Hände gespitzt, die Arme gestreckt. Hassler hatte rote Augen vor Glück, hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt, sie waren rot vom Chlor, aber er lachte, und es musste Glück sein, was aus seinen großen Vogelaugen troff.
Und dann saßen wir auf der Bank neben dem Becken, und Hassler griff in den Beutel, er machte es spannend, ich habe gewichst, sagte er, es ist so weit, ich habe es mit. Gleich werde ich’s zeigen. Wie sieht es aus?, fragte ich. Gleich, sagte der Vogel, ich zeig’s nur dir, es ist ein Geschenk, ich dachte an dich, als ich rubbelte und rieb. Wie sieht es aus, ist es klebrig? Oh nein, sagte der Vogel. Er zog einen langen durchsichtigen Schlauch aus seinem Sack. Samen, sagte Hassler, echter Samen, von mir. Es war ein langes ausgerolltes Präservativ, das er da hielt, es baumelte zwischen uns, Hassler wieherte still, echter Samen, echter Samen von mir, sagte Hassler. Wo, fragte ich dann. Na unten, im Reservoir, hier schau’s dir an.
Der Gummi roch nach Fahrradschlauch, ich kannte den Geruch gut, er war stechend und fremd, er schnitt durch den Schwimmbadodor wie eine heiße Klinge durch kalte Butter. Mein Samen, frisch gewichst, heute morgen. Das da unten? Ja genau, sagte Hassler. Es waren schwarze Körnchen, sah aus wie Mohn. Das ist der Samen? Genau. Das ist der Samen. Ich dachte an dich, meine Freundin, als ich rubbelte und rieb. Hassler rollte den Gummisocken zusammen und steckte ihn in meine Bademanteltasche. Für dich. Weil du mir beim Kopfspringen zugesehen hast. Das war mein erster Sex. Ein kleiner Handel.
Vorabdruck in Falter 35/2008 vom 27.8.2008 (Seite 52)
Boboville ::: Handelnde Personen
 Hugo Wiener und Cissy Kraner. Christian Broda, der Dusl-Onkel mit den Bauchhosen. Thomas Glavinic, genannt Glawischnig. Charlotte Feuchtgebiet und Boboobergott Harald Schmidt. Der Gott der Hakenkreuze. Theodor-Herzl. Ein Bonbongeschäftbesitzerin, genannt die Bonbonische. Ein Herr Katechet. Schwester Benedicta aus der Klosterschule. Klara Polacek, die Tochter vom Fleischhauer. Emanuel Izuagha und Markus Adegboye, zwei durch Taufe aus der Hölle Gerettete. Jachin und Boas. Zahnarzt-Torquemada Dr. Czingler, Dr. Mengele. Woody Allen. Stan Laurel und Oliver Hardy. Jacques Tati und Buster Keaton. Groucho, Chico, Harpo, Gummo, aber nicht Zeppo Marx. Jason King. Freddie Mercury, der Mann, der mich vor den Nonnen rettete. Eine Notzahnärztin. Ein Sandler. Muckenstrunz auf seinem Kinderfahrrad. H.C-Strache. Ein camelrauchender Koch. Ein goldringpaffender Krocha. Erik, ein Artdirektor. Mein friulanischer Vater. Pasolini. Elmar Platzgummer, der Mann der mich das Brennen lehrte. Dr. Michael Mignon ein Lomograph. Der Kabarettist Maurer und sein scharfes Messer. Larry David. Ein Peterrappbärtiger. Der Jakobsleiternkletterer Daniel Kehlmann. Doris Knecht. Loriot. Der Phil-Mann aus der Lampenbuchhandlung. Bob Dylan. Zladjan, ein Drogengroßhändler. Johnny Guitar Watson. Mein bester Freund: Das liebe Triebi. Synox, der mir das Filmen schenkte. Lovisa Gustafsson genannt Greata Garbo. Mützenmann Josef Mikl. Mein lieber Kurt. Der Hofermichi. Schrom, ein Architekt aus Boston und Santa Fé. Otto, ein Innenarchitekt. Stefan Tempel. Mein Vaterbruder Erich, ein Architekt. Synoxens zappelnden Backfischtöchter. Eine zeichnende Israelin. Savo Petric, ein Hollywoodfriseur, mit Gatten in Weiss. Harry Hassler, der Junge, der mir seinen Samen brachte. Brian May, genannt Breihenmeh. Der Herr Ingeniör. Gitarrenhändler Richie Friedman aus der 48ten Strasse. Der Platzgummerhans. Der Modeschöpfer Klaus Höller und seine Freundin Catwoman. Filmemacherin Martina Theininger. Thomas Bernhard und Glenn Gould. Pippi Langstrumpf. Grissemann, Stermann, Franz Schubert. Erich Kleiber. Napoleon, Black Sabbath. Wolfgang Muthspiel. Ein pakistanische Trafikant. Helmut Schmidt, der Mann mit den Mentholzigaretten. Ein Boychnik aus Katz’s Kosherem Deli. Die Wachalowskibrüder. Nancy und Ronald Reagan. Heidi List. Hitler, Himmler, Joe Walsh. Randy Garcia, Dickie Betts, Leslie West. Der kauzige Gnom aus dem Santo Spirito. Olga, die Frau, aus deren Hände Blitze schlagen. Netrebko und Villazon. Marcello Mastroianni und Anouk Aimée. Albert Hofmann, der Erfinder de LSD. Das Mountain Girl Carolyn Adams. Jerry Garcia von den Grateful Dead. Paul Kantner von Jefferson Airplane. Klaus Nüchtern, ein Lesefreund. Francesca Habsburg-Thyssen. Jimi Hendrix. Frank Zappa. Johnny Guitar Watson. Fertigdenker Schuh und Sloterdijk. Hans Hurch, der bei mir alles darf. Peter Handke, dem Alles gelingt. Die Kollegen Ruzowitzky, Spielmann, Kreihsl. Armin Thurnher, Chefkommentator der Bobovillage Voice. Santana, der Mann, der den Boogie fand. Die Architekturbesinnungsgruppe. Corns Porsche. Hiram Abif, ein Baumeister aus Tyros. Hermes Phettberg, ein Stapler. Jim Hawkins, Schiffsjunge. Kollege David Rühm. Robert Menasse und sein Doppelgänger. Gerald Votava, ein Bobo. Zita, eine Radiofrau. Die Lomographen. Rotor ein Taxi fahrender Boxer. Bagrat, ein georgischer Etablissementbesitzer und Rusudan, seine Frau. Der Mann im sowjetischen Trainingsanzug. Der Mann mit dem ausgeborgten Haar. Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin. Andrej Turkin, der Dichter, der vom Balkon fiel. Tex Rubinowitz. Christopher Wurmdobler und Lolek Tomtschek.
Hugo Wiener und Cissy Kraner. Christian Broda, der Dusl-Onkel mit den Bauchhosen. Thomas Glavinic, genannt Glawischnig. Charlotte Feuchtgebiet und Boboobergott Harald Schmidt. Der Gott der Hakenkreuze. Theodor-Herzl. Ein Bonbongeschäftbesitzerin, genannt die Bonbonische. Ein Herr Katechet. Schwester Benedicta aus der Klosterschule. Klara Polacek, die Tochter vom Fleischhauer. Emanuel Izuagha und Markus Adegboye, zwei durch Taufe aus der Hölle Gerettete. Jachin und Boas. Zahnarzt-Torquemada Dr. Czingler, Dr. Mengele. Woody Allen. Stan Laurel und Oliver Hardy. Jacques Tati und Buster Keaton. Groucho, Chico, Harpo, Gummo, aber nicht Zeppo Marx. Jason King. Freddie Mercury, der Mann, der mich vor den Nonnen rettete. Eine Notzahnärztin. Ein Sandler. Muckenstrunz auf seinem Kinderfahrrad. H.C-Strache. Ein camelrauchender Koch. Ein goldringpaffender Krocha. Erik, ein Artdirektor. Mein friulanischer Vater. Pasolini. Elmar Platzgummer, der Mann der mich das Brennen lehrte. Dr. Michael Mignon ein Lomograph. Der Kabarettist Maurer und sein scharfes Messer. Larry David. Ein Peterrappbärtiger. Der Jakobsleiternkletterer Daniel Kehlmann. Doris Knecht. Loriot. Der Phil-Mann aus der Lampenbuchhandlung. Bob Dylan. Zladjan, ein Drogengroßhändler. Johnny Guitar Watson. Mein bester Freund: Das liebe Triebi. Synox, der mir das Filmen schenkte. Lovisa Gustafsson genannt Greata Garbo. Mützenmann Josef Mikl. Mein lieber Kurt. Der Hofermichi. Schrom, ein Architekt aus Boston und Santa Fé. Otto, ein Innenarchitekt. Stefan Tempel. Mein Vaterbruder Erich, ein Architekt. Synoxens zappelnden Backfischtöchter. Eine zeichnende Israelin. Savo Petric, ein Hollywoodfriseur, mit Gatten in Weiss. Harry Hassler, der Junge, der mir seinen Samen brachte. Brian May, genannt Breihenmeh. Der Herr Ingeniör. Gitarrenhändler Richie Friedman aus der 48ten Strasse. Der Platzgummerhans. Der Modeschöpfer Klaus Höller und seine Freundin Catwoman. Filmemacherin Martina Theininger. Thomas Bernhard und Glenn Gould. Pippi Langstrumpf. Grissemann, Stermann, Franz Schubert. Erich Kleiber. Napoleon, Black Sabbath. Wolfgang Muthspiel. Ein pakistanische Trafikant. Helmut Schmidt, der Mann mit den Mentholzigaretten. Ein Boychnik aus Katz’s Kosherem Deli. Die Wachalowskibrüder. Nancy und Ronald Reagan. Heidi List. Hitler, Himmler, Joe Walsh. Randy Garcia, Dickie Betts, Leslie West. Der kauzige Gnom aus dem Santo Spirito. Olga, die Frau, aus deren Hände Blitze schlagen. Netrebko und Villazon. Marcello Mastroianni und Anouk Aimée. Albert Hofmann, der Erfinder de LSD. Das Mountain Girl Carolyn Adams. Jerry Garcia von den Grateful Dead. Paul Kantner von Jefferson Airplane. Klaus Nüchtern, ein Lesefreund. Francesca Habsburg-Thyssen. Jimi Hendrix. Frank Zappa. Johnny Guitar Watson. Fertigdenker Schuh und Sloterdijk. Hans Hurch, der bei mir alles darf. Peter Handke, dem Alles gelingt. Die Kollegen Ruzowitzky, Spielmann, Kreihsl. Armin Thurnher, Chefkommentator der Bobovillage Voice. Santana, der Mann, der den Boogie fand. Die Architekturbesinnungsgruppe. Corns Porsche. Hiram Abif, ein Baumeister aus Tyros. Hermes Phettberg, ein Stapler. Jim Hawkins, Schiffsjunge. Kollege David Rühm. Robert Menasse und sein Doppelgänger. Gerald Votava, ein Bobo. Zita, eine Radiofrau. Die Lomographen. Rotor ein Taxi fahrender Boxer. Bagrat, ein georgischer Etablissementbesitzer und Rusudan, seine Frau. Der Mann im sowjetischen Trainingsanzug. Der Mann mit dem ausgeborgten Haar. Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin. Andrej Turkin, der Dichter, der vom Balkon fiel. Tex Rubinowitz. Christopher Wurmdobler und Lolek Tomtschek.
Sowie circa 367 weitere Personen.
Vorabdruck in Falter 35/2008 vom 27.8.2008 (Seite 52)
Boboville ::: Lesungen
 Präsentation:
Präsentation:
24.9., 19h: Präsentation im Schikanederkino
Wien 4., Margaretenstrasse 24
Weitere Lesungen:
20.9., 13h: Rund um die Burg
Lesezelt vor dem Wiener Burgtheater
27.9., 21h: Loisium Langenlois
Langenlois, Niederösterreich
8.10., 13h: Buchhandlung Thalia Landstrasse
Wien 3, Landstrasse
Schauermolke in Bobopol
Gestern, auf einer Party im düsteren Teil von Boboville (im Wiener Stadtteil Josefstadt, im Häuserblock zwischen den ehemaligen Hauptquartieren von KGB und CIA). Der Filmregisseur mit der holprigen Biographie und dem schönen Haar hat Geburtstag und kocht. Zwei Dutzend Artischocken, einen riesigen Topf Tintenfisch. Der Hausherr, ein Verlagsleiter, der in seiner Blutjugend Sekretär von Bruno Kreisky war, urlaubt auf Bali. Sturmfreie Bude in den Bobo-Salons.
Ein Prinz ist da, verarmt und kunstsinnig, mit einem tausendjährigen Namen der mit “Hohen” beginnt und mit “Lohe” endet. Ein philosophierender Pater mit einer Brille, wie sie ausser ihm nur der Zirkusdirektor Bernhard Paul trägt, eine Zahnärztin, ein Theologe, ein Französischlehrer, ein Bildersammler. Mein bester Freund, der den Laden hier schmeisst, ist Maler. Vor zehn Jahren hat er die fahle Gründerzeitwohnung in einen Trompe-l’œil-Palast verwandelt, gegen den Neuschwanstein wie ein Bauhausappartement wirkt. Seine ehemalige Mitstudentin, eine Restauratorin mit Hang zu schrillen Retrokostümen, noch eine Malerin, die das Schlichte liebt und mit einem privatisierenden Philosophen liiert ist.
Die Artischocken sind heiss und saftig. Statt Limonenbutter gibt es Olivenöl aus der Toskana. Von einem befreundeten Gutsbesitzer, der nebenbei Millionär ist und sich von Mozartpartitiuren ernährt. Die Tischgespräche oszillieren zwischen Erörterungen über die Kraft des barocken Gesimseprofils, falschen Rembrandts und der Entwurfstechnik von Coop Himmelblau (Kartonreste und Haarföhn). Der Eintopf ist schmackhaft, der Octopode zäh. Der Französischlehrer trägt feinstes englisches Tuch, hat blendende Manieren und sprudelt Anekdoten aus Oberösterreich über den Tisch. Der schwule Chemiker ist laut und melancholisch. Der Architekt redet über seinen Fetisch: Das elegante Automobil. Die Seitenblickemoderatorin ist leise und glücklich, dass das hier privat ist.
Zu Mitternacht wird Schauermolke entkorkt und Sektflöten nass gemacht. Geburtstag hat etwas von Sylvester. Es ist dunkel und zu warm für die Zeit. Die Menschen hier kenne ich seit Jahrzehnten und doch habe ich sie in den letzten sechs Jahren kaum gesehen. Plötzlich sind sie wieder da, wie die Überlebenden einer Flut. Die Seitenblickemoderatorin fragt mich leise und mit einem feurigen Blitzen in den Augen: “Und wie hast Du die dunkelschwarze Zeit überlebt?”